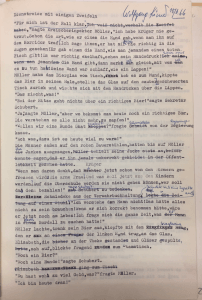Ruhrprovinz der 80er-Jahre, jüngere deutsche Literaturgeschichte, Literaturbetrieb und Autoreneitelkeiten: Das sind nur einige der Themen des erfrischenden und nur gelegentlich nervenden Klute-Romans, dessen Ungereimtheiten ein guter Lektor hätte ausbessern müssen.

Der Schriftsteller Hilmar Klute (Foto: © Jan Konitzki)
Was für ein schöner und ärgerlicher Text ist doch der 365 Seiten starke Roman Hilmar Klutes, der in der Süddeutschen Zeitung die Kolumne „Streiflicht“ mitverantwortet und neben einem Kriminalroman auch eine lesenswerte Ringelnatz-Biografie vorgelegt hat. Den Titel seines Romans hat sich Klute bei Peter Rühmkorf ausgeborgt, er lautet wie die Anfangszeile des Parlandogedichts „Phönix voran“: „Was dann nachher so schön fliegt…“ heißt es da und entzaubernd-lakonisch in der zweiten Zeile: „wie lange ist darauf rumgebrütet worden.“
Lange gebrütet haben dürfte der 1967 in Bochum geborene Klute auch an seinem hochfliegenden Entwicklungs-(Verzeihung: Coming of Age-)Roman, der bereits 2018 im Galiani Verlag erschien und mittlerweile seine vierte Auflage erlebt.
Der Roman wurde von der Kritik gelobt bis gefeiert, vor allem Christine Westermann gab sich im Literarischen Quartett gewohnt sturzbetroffen: „Ich bin total begeistert. Es ist immer so blöd, wenn man sagt ,Mein Lieblingsbuch des Jahres’, aber das kommt dicht dran. … Dieser Mann hat eine unglaublich feine Sprachkraft.“ Ja, hat er, aber auch eine Kritik verdient, die ein paar Argumente böte.
Drei Erzählebenen, ineinander verwoben
Herbst 1986, Orte und handelnde Personen der ersten Ebene stammen vor allem aus dem Ruhrgebiet. Der Zivildienstleistende Volker Winterberg hat ein eher mäßiges Abitur abgelegt, versteht sich als Lyriker und erklärt gleich zu Beginn des Romans „Ich wollte schreiben und irgendwann mit dem Schreiben mein Auskommen finden.“ Das ist sympathisch größenwahnsinnig, vor allem für einen Lyriker, zumal die wenigen Gedichte Winterbergs, die uns der Roman präsentiert, noch weit entfernt sind von dem, was dann auch immer so schön „eine eigene Stimme“ heißt.
Klute zeichnet seinen janusgesichtigen Möchtergernschreiber zwischen Selbstbehauptung und Wachstumsschmerzen mit viel Sympathie. Winterberg scheint ein Womanizer zu sein, hat Charme, Witz, zeigt gelegentlich sogar Selbstironie, hat aber lieber noch beißenden Spott für seinen Mitmenschen übrig. Dass er mitunter auch zum literarischen Scharfrichter werden kann, ist einer der rigorosen Züge Winterbergs, der vorschnelle Urteile nicht scheut.
Artist im Altenheim, ratlos
Nach einem Kurztrip des irrlichternden Jünglings, dessen Ziel Paris ist, wird er als Berufslyriker in spe zunächst einmal zwischengelagert: als Zivi im funktionalen Leerlauf eines Bochumer Altenheims. Was er dort erlebt, in welcher Sprache er davon erzählt, das findet der Leser in den stärksten Passagen des Romans. Das Altenheim bietet ein Panoptikum der Debilen und Dementen im Wartezimmer des Todes. „Ich betrachtete Herrn Feist und begann mich in die Idee der Verblödung zu verlieben. Wenn sich die Argumente selbst genügen und keinen Abgleich mit den Argumenten der anderen benötigten, hatte man sich dann nicht ein Königreich zurückerobert?“, so beschreibt Winterberg die Lage an der Arschabwischfront.

Die Pfleger halten sich das Elend der Alten durch Routine, Verachtung und Zynismus vom Leib. Mit einer dreizehn Jahre älteren Pflegerin fängt Winterberg ein pragmatisches Verhältnis an: „Ich hatte keine große Lust auf den Sex mit Erika. Mein Schwerpunkt lag ja auch mehr auf der Lyrik (…)“. Die dröhnend-antifaschistische Erika liest dem Jüngling nicht nur die politischen Leviten, man trifft sich in einem Liebesnest und Erika ist es auch, die dem 20-Jährigen beisteht, wenn Gegenwind aufkommt, weil er sich als unsicher-arroganter Kotzbrocken mal wieder offiziell über die Kollegen beschwert, sie direkt abmeiert oder sich zum Schluss von Freunden mit dem Transparent „Hier regiert die Mittelmäßigkeit“ verabschieden lässt. Doch wo Arbeitstristesse lauert, wächst das Rettende auch: In der WAZ liest Winterberg von einem Jungautoren-Wettbewerb der Berliner Festspiele, bewirbt sich und wird tatsächlich eingeladen.
Hauptstadtzirkus mit Nebenwirkungen
Die Reise nach Berlin, die Begegnungen rund um ein Schreibseminar im Literaturhaus an der Fasanenstraße gehören zur zweiten Erzählebene des Romans, verwoben mit der dritten, jenen Tagträumereien, in denen sich Winterberg zwischen den Nachkriegsgrößen der westdeutschen Literatur auf Treffen der Gruppe 47 imaginiert, mal als Teilnehmer, mal als Organisator, aber nie auf dem berüchtigten elektrischen Stuhl neben Hans Werner Richter.
In Berlin trifft Volker Winterberg, „aufgeladen (…) mit der Erwartung an ein anderes Leben“, auf Katja, „eine Servicekraft der Literaturförderung“. Zwischen beiden wird sich im Laufe des Romans so etwas wie eine Liebesgeschichte entwickeln, die nach der Rückkehr ins Ruhrgebiet und einem neuerlichen Besuch in Berlin sachte versandet. Winterberg findet aber auch einen Gegenspieler, Freund, schwulen Verehrer, ausgebufften Karrieristen, romantisch-sensiblen Schreiber, Großtöner: Thomas heißt der und Klute zeichnet ihn differenziert und verletzlich. Irgendwann versucht Thomas vor dem Kleist-Grab Volker zu küssen und muss danach mit der Abfuhr leben.
Sind Katja und Thomas noch komplexe Figuren des Berliner Personals, so finden sich neben ihnen viele überzeichnete Typen, Karikaturen des Literaturbetriebs allesamt. Leiter von Schreibworkshops erhalten ebenso ihr Fett weg wie die jungen Kollegen und Konkurrenten Winterbergs: Sensibelchen, die Blümchen-Lyrik schreiben, junge Wilde, Science-Fiction-Nerds oder Dichterdarsteller mit Ewigkeits-Anspruch. Dass Texte in den Achtzigern bitteschön „Suchbewegungen“ zu vollführen haben, wird ebenso veräppelt wie impotente Schriftsteller, die sich aufs Trösten junger Poetinnen spezialisieren.
Er sieht das Ruhrgebiet endlich aus größerer Distanz
Winterberg selbst scheint an seinen Reisen nach Paris und Berlin zu wachsen, er lernt Facetten der Liebe kennen, sieht das Ruhrgebiet endlich aus größerer Distanz, setzt sich meinungsfreudig mit Texten und Theorien auseinander und lernt bei Berliner Losern: „Langsam und freundlich verrückt zu werden – das war auch eine Möglichkeit, ohne Schmerzen durchs Leben zu kommen.“
Bei den Bochumer Alten erlebt er andererseits, dass es „ungeheuer schwer“ ist, „im Alter ohne den Schatten der Demütigung zu leben“. Sein geliebtes Notizbuch, in dem er seine „Vorstellung vom alleinreisenden Dichter“ kultiviert, „der die Fremde sucht und aus der Fremde großartige Texte destilliert“, verbrennt Winterberg zum Schluss seiner Reisen, die ihn auch in die Nähe von Lebensorten Nicolas Borns führen. Er ist jetzt um Erfahrungen reicher und um Gewissheiten ärmer, und tritt doch neu und etwas pathetisch ein in den ewigen Kreislauf von Illusion und Enttäuschung: „Jetzt konnte ich endlich anfangen.“
Überfrachtung und Verstiegenheit
Unbestritten: Es ist wirklich beachtlich, wie Klute in „Was dann nachher so schön fliegt“ Roadmovie, Liebesgeschichte, Entwicklungsroman, fragmentarischen Künstlerroman, Satire und Personenporträts gekonnt montiert. Doch bei der oft gelungenen Montage unterlaufen ihm leider auch Konstruktionsfehler.
Der erste besteht darin, dass Klute seinen 20-jährigen Protagonisten in jeder Hinsicht mit literarischer Bildung und kritischer Weltsicht überfrachtet. Zu oft zieht da der Romancier seinen Helden an der kurzen Leine zu sich herüber, bis Winterberg als Figur und Sprecher immer unglaubwürdiger wird, weil er so alt und klug fabuliert, wie er es nie und nimmer sein kann. Das erinnert an jene enervierenden Kinderbücher, in denen der Autor die Kinder zum Sprachrohr eines pädagogisch-aufklärerischen Programms macht und ihnen so die Luft zum Atmen nimmt.
Dabei kann man noch einverstanden sein mit dem, was Klutes Winterberg zu fiktiv-realen und erträumten Begegnungen mit seinen Idolen Rühmkorf, Heiner Müller oder Günter Eich zu erzählen weiß. Aber wenn dem Leser nach vielfach ermüdendem Name-Dropping auf zwei Buchseiten noch einmal fünf Lyriker und Zitate (Born, Rilke, Benn, Fried, Bachmann; S. 244/45) um die Ohren gehauen werden, klingt all das mehr nach Seminararbeit als nach virtuosem Roman.
Solche Verstiegenheit schlägt sich auch sprachlich nieder, wenn Winterberg etwa räsoniert: „,Du gehörst in eine richtige Autorenschule, lieber Volker‘, sagte er wie ein C3-Professor, der einem leicht bräsig wirkenden, aber mit vielen Talenten gesegneten Studenten eine miserabel bezahlte HiWi-Stelle anbieten will.“ Und über Erika gründelt er: „(…) Erika, die jetzt neben ihrem alten Lebensgefährten schlief, ohne schlechtes Gewissen, weil die Promiskuität eine Gratisbeigabe ihrer Generation war.“
Das und vieles mehr sagt ein 20-Jähriger? Wer’s glaubt. Jedenfalls scheint die Figurenperspektive eines zugegeben aufgeweckten Jünglings reichlich oft durchlöchert und es ist der Autor, der als Bescheidwisser durch eben diese Löcher grüßt. Da hilft es auch nicht, wenn Winterberg – kritischen Einwänden vorbeugend – von seiner „kleinen dandyhaften Verächtlichkeit des verblasenen Klugscheißers“ sprechen darf. Das gibt zwar erzählerischen Spielraum für allerhand Bildungsprotzerei mit Angelesenem, erlaubt aber beileibe nicht, den Horizont der Figur durch den des Autors zu ersetzen.
Tagträumen als Vorwand
Genau dies führt direkt zum zweiten Konstruktionsfehler des Romans. Klutes Hang, dem Jungautor der 80er-Jahre auch eigene Ansichten unterzujubeln, führt oft zu einer Kulissen- und Figurenschieberei, bei der Klute ganz nach Belieben die Mitglieder der Gruppe 47 oder kleinere Literaturlichter des Ruhrgebiets wie Hugo Ernst Käufer bloß als grob geschnitzte Marionetten auftreten lässt, Kritikerschelte übt und ganze Literaturströmungen abmahnt.
Zwar wird dies alles im Roman als Tagträumerei des Protagonisten ausgewiesen, scheint dem Autor von heute aber vor allem Lizenz dafür zu sein, angelesenes oder eigenes Insider-Wissen über die Gruppe 47, Nachkriegsliteratur, die literarische Szene des Ruhrgebiets und den Literaturbetrieb insgesamt auszustellen, weit über jede Lebens- oder Lese-Erfahrung eines 20-Jährigen hinaus. Wie das tapfere Schneiderlein erledigt Winterberg alias Klute z. B. die wichtigsten Vertreter der konkrete Poesie mit nur wenigen Zeilen, Jandl lässt er gar mit einem Satz verschwinden: „Die Sprache ist doch viel, viel schöner als alle deine Gedichte, Ernst Jandl.“
Problematisch auch, wenn Hilmar Klute den jungen Winterberg übers Ruhrgebiet immer mal wieder so sprechen lässt, wie es einst der bewunderte Nicolas Born tat. In solchen Romanpartikeln kommt Klute selten über mittlerweile veraltete Stadt- und Landschaftsschilderungen Borns hinaus, wie man sie kennt aus dessen Gedichten, Briefen oder ersten beiden Romanen „Der zweite Tag“ und „Die erdabgewandte Seite der Geschichte“. Da, wo Winterberg per Intercity das Ruhrgebiet verlässt oder wieder ins Revier einfährt und dies kommentiert, tönt es fast wie beim frühen Born selbst, geschrieben aber ist es eben Jahrzehnte später.
Jungautor als Poetenschreck demontiert vor allem sich selbst
Tatsächlich peinlich berührt ist man als Leser da, wo Klute seinen Winterberg über Erich Fried schwadronieren lässt, den er im Sommer 1986 in Recklinghausen sieht und hört. „Fried war eine groteske Erscheinung, ein übergroßer Kopf auf einem kleinen gedrungenen Körper – der Mann sah aus, als sei er aus zwei verschiedenen Menschen zusammengeschraubt worden. Er gab sich betont gebrechlich, kam immer erschöpft lächelnd in den Raum, auf einen hellen Stock gestützt, in der anderen Hand eine Plastiktüte mit seinen Gedichtbänden, die er alle bereits signiert hatte.“
(Nun, das sei dem sprachverliebten Romanhelden, dessen Autor wie dessen Lektor doch vorgehalten: Es muss zu Anfang selbstverständlich heißen: „- der Mann sah aus, als wäre er“, bitte ändern!)
Arg verspätetes Fried-Bashing, dreist aufgebügelt
Fried-Bashing findet man noch einige Male in Klutes Roman, ein alter Hut des bundesdeutschen Feuilletons, schäbig und abgetragen, hier noch einmal ohne Not dürftig aufgebügelt. Warum ein 2018 erscheinender Roman seinen Protagonisten dieses Zeugs noch einmal aufsagen lässt, bleibt unerklärlich, da wird kraftmeierisch nachgetreten ins Leere. Zudem: Die körperlichen Besonderheiten des aus Nazi-Deutschland geflohenen Fried so abgeschmackt zur Sprache zu bringen, das ist schlicht stillos vorgetragen, wenn nicht vom ahnungslosen Protagonisten, so doch vom Autor.
Hilmar Klute hat bei einer Lesung im Literaturhaus Herne Ruhr erzählt, dass er als junger Mann (anders als sein Protagonist) Erich Fried „toll“ fand. Die Frage steht dennoch, ob man als Autor auf Effekte spekulierend einen Fried-Popanz aufbauen darf, um der eigenen Figur mehr dreiste Kontur zu geben. Was Klute seinem Jungautor in den Mund legt, kann und muss Klute einfach besser wissen, zumal der Roman und sein Held an Besserwisserischem sonst nicht sparen. Erich Fried jedenfalls hat im Sommer 1986 bereits zwei Darmkrebsoperationen hinter sich, er „gab“ sich nicht gebrechlich, er war gebrechlich. Er „kam immer erschöpft lächelnd in den Raum“? Ja, sicher, vielleicht, weil er oft erschöpft war?
Aber vielleicht wissen das Winterberg und sein Erfinder nicht? Jedenfalls geben sie pathetisch vor, John Donnes Gedichtzeile „Each man’s death diminishes me“ ernst zu nehmen, aber im Falle Frieds scheinen sie fahrlässig bloß damit zu spielen.
Hilmar Klute: „Was dann nachher so schön fliegt“. Roman. Verlag Galiani, Berlin. 365 Seiten, 22 Euro.
 Wie viele nette Stunden haben wir auf der Terrasse des Ehepaares Schrahn/Demirsoy verbracht oder auf ihrem gemütlichen Sofa. Einmal im Jahr gab es Apfelkuchen für alle Freunde – sozusagen aus dem eigenen Garten. Denn das Bäumchen, das wir beiden zur Hochzeit geschenkt hatten, trug ziemlich schnell Früchte.
Wie viele nette Stunden haben wir auf der Terrasse des Ehepaares Schrahn/Demirsoy verbracht oder auf ihrem gemütlichen Sofa. Einmal im Jahr gab es Apfelkuchen für alle Freunde – sozusagen aus dem eigenen Garten. Denn das Bäumchen, das wir beiden zur Hochzeit geschenkt hatten, trug ziemlich schnell Früchte.









 „Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt
„Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt


 Subversive Muse
Subversive Muse