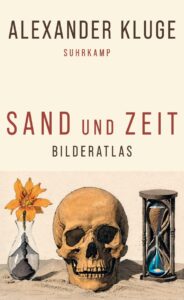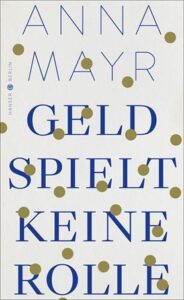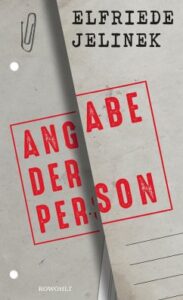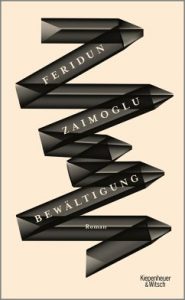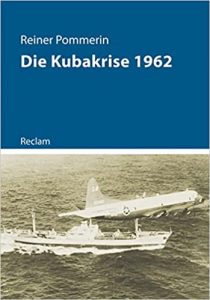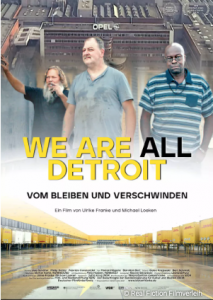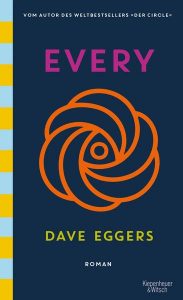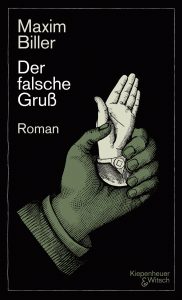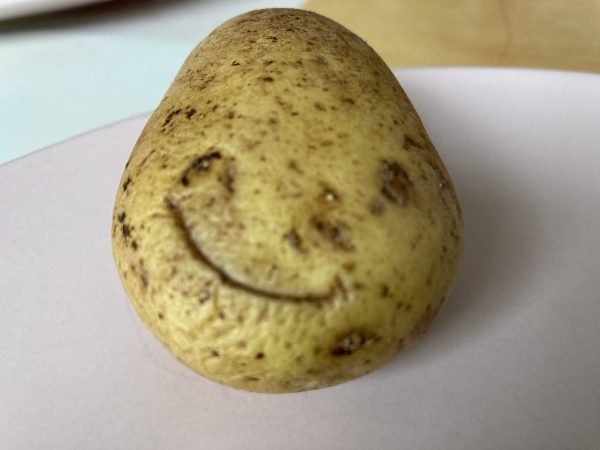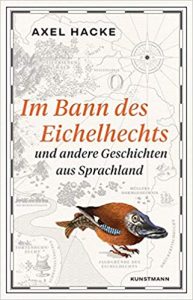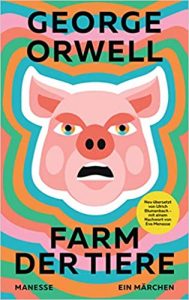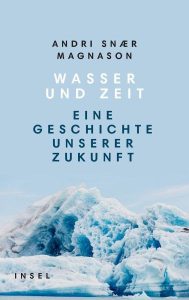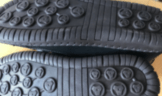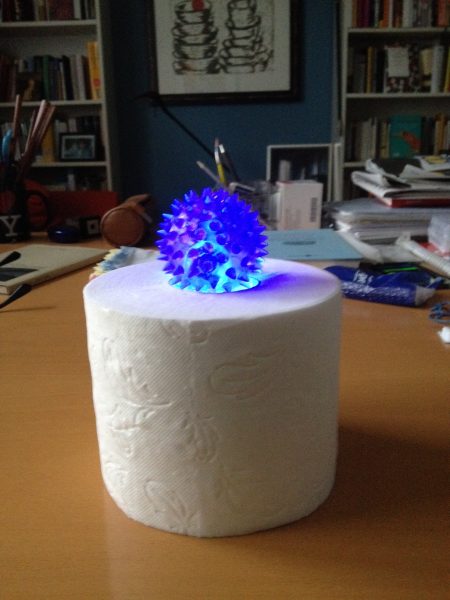Berg & Klammern, Bus & Eile
Bisher: Herr Scherl, Held unserer Erzählung, will seit Tagen eine nötige social-media-Pause machen, er kommt aber nicht dazu, weil immer was dazwischen kommt (für dieses »zu – zwi« müßt man (=ich) mal was erfinden. Nà, heut nicht mehr).
Zu Anfang dieser Aufzeichnungen weilt er nach einem Arzt-(genauer: Ärztin-)besuch (nur was abholen, da muß man sich ja wegen jedem Mist selber materialisieren) wie immer in der Eisdiele seiner Wahl, wo er, wie immer, zeichner- und soziologische Studien betreibt.
Klar, Wohlstand usw usf, wie immer. Faules Künstlerpack – nix arbeiten, aber immer Pause machen und rauchen und immer Kaffee saufen. Oder noch Schlimmeres! Jaja… (ja – ich weiß, was »jaja« heißt, deswegen schreib ichs ja hin)
Bei der Doktorette haben sie sich wieder gefreut, weil ich da (wie immer) so fleißig die Aquarelle vom Doktorettenvadder anguck: Anfang-Mitte des Jahrhunderts (ja freilich des vergangenen, Mensch!), allesamt Bergmotive und teils gar nicht schlecht (und wenn ich das sag, dann wills was heißen). Und heut wars sogar eins, das ich noch nicht entdeckt hatte.
Ich wart also auf der Doktorettes Kaiser Wilhelm für die Überweisung und guck Aquarelle und es freuen sich: die Doktorette, vier (sic!) Doktorettenhelferinnen (Doktoreusen waren heut keine da, zu wenig Siechen bei dem schönen Wetter) und einer, bei dem ich noch nicht rausgekriegt hab, was er da treibt. Aber er macht die Ansagen auf dem AB und ist glaub der Olle von der Doktorette (und spricht wirklich, nuja – »angenehm«. Dachte immer, das sind gekaufte Intros, bis ich ihn neulich mal himself am Apparat hatte. Konnt erst gar nix sagen, so hab ich mich erschrocken). Wird also Büroleiter oder sowas sein und aufpassen, daß die Doktorette und die Doktoreusen und die Doktorettenhelferinnen alle alles richtig machen.
Brot noch, bin schon wieder unter Meldestufe »Obacht!«. Der Bäck hatte aber natürlich grad Feierabend bzw die Bäckerin (ja-doch, ich mach ja schon ganz genau: die Bäckereifachverkäuferin, wie man brav-bundesdeutsch ja sagen muß) die Kasse abgesperrt (das ersetzt heut auch Gott: »Ich kann nix tun, Kasse ist schon zu, tja!«) und die Eisdiele macht auch gleich dicht und kalt ists eh und ich muß noch zum andern Bäcker dackeln. Oder auch nicht. Gibts eben nix. Oder nur Wurscht. Haha! Künstler halt.
(…)
Jetzt aber zum Bus – husch husch!, damit er mir nicht wieder vorm Näschen wegfährt und ich ne halbe Stunde warten muß (auch wieder): gegenüber vom Dönershop und neben meiner einstigen Stammkneipe (aber das ficht mich ja nicht mehr).
Guck ins Schuhladenschaufenster (kurz!): die roten in gelb bitte, in meiner Größe und zu nem Preis, den ich zahlen kann.
Ich hör die Schuhladenfachverkäuferin vor meinem inneren Auge ganz leis kichern (wenn man jemanden vor dem inneren Auge … na, wurscht (darf man ( =ich) das jetzt noch »Wurscht« nennen? (Auch wurscht)))((Irgendwann vergeß ich bestimmt mal, ne Klammer zuzumachen)(oder auf (?))(… naja … wobei … eigentlich ist mir bei denen die Spitze zu spitz: also nee (sprach ich, Fuchs (zu den Trauben)))
Und vielleicht nen Kalender: links ne Eisdielenzeichnung, rechts das Eisdielenzeichnungsambientefoto und hinten druff der Text dazu. Das wär doch was. Oder hinten das Eisdielenzeichnungsambientefoto und der Text. Und so, daß mans so oder so aufhängen kann. (Pin im Brägen: Drucker wegen nem Angebot fragen (und Werbung dafür machen)) Da darf der Text aber nicht zu lang … husch husch!
Quatscht mich einer an, mit irgendwas Grünem an den Klamotten, grünes Basecap, nen grünen Baumel um den Hals und was man halt noch so anhaben muß als junger Mensch, der sich von der uniformierten Masse abhebt. Daneben zwei andere mit dem gleichen Fummel, der aussagt, daß sie sich auch von der uniformierten Masse abheben.
Ich hab erst gar nicht verstanden, was der Knilch von mir will, weil er so geredet hat, wie man als junger Mensch so reden muß, wenn man sich von der uniformierten Masse abhebt.
Habs dann aber – trotz Bus & Eile! – aus ihm rausgekriegt (curiosity killed bekanntlich the cat): von Greenpeace sei (ah, daher der ganze grüne Plunder) er, beziehungsweise sie, und sie würden diese Woche und hier – und nestelt was herbei, das um seinen (ah, der Baumel) Hals hängt – sei sein Ausweis und …
»… und ihr wollt jetzt Geld von mir«, feix ich ihn an.
»Äh … ja«: er.
»… und das hab ich keins«, ich, immer noch guter Dinge.
Die anderen Knilche eilen ihm zur Hülf:
»Ja, aber«
»Nur noch«
»Greenpeace«
»Umwelt«
Ich: »Muß zum Bus. Hab eh kein Geld«, schon ein bisserl ungehalt’ner und geb Gas – Bus, halbe Stunde, gegenüber vom Dönermann (und neben meiner Stammkneipe, meiner einstigen (aber das ficht usw usf)).
»Wir brauchens auch erst in zwei Wochen«, knödelt Knilch zwo.
Ich seh den Bus abfahren. Und gleich dahinter den zweiten. Halbe Stunde, Dönershop, Stammkneipe (aber).
»Alter! Ich bin Künstler! Das, was ich im Monat hab, verfreßt ihr in einer Woche, mindestens. Und da fährt mein Bus!« und versenge alle drei mit meinem Flammenblick.
Ok – halbe Stunde. Ich guck die Preisliste vom Dönerladen an und frag mich, wieso ich die Preisliste vom Dönerladen anguck: Pommes Dreifuffzig, Döner Sechsfuffich, Bratwurschtn Fünfer. Nee, laß mal. Hab nochn halbes Butterbrot im Rucksack und da kommt eh der Bus.
Text, keine Korrekturen: zwanzig Minuten. Paßt doch. Und auf dem Heimweg pfeif ich mir an kleijnes Liedl.
(Aber Pause hab ich heut nicht gemacht (schon wieder (nicht)))
Anmerkung: das mit der halben Stunde und den keinen Korrekturen war natürlich, wie immer, nicht gelogen (damals).
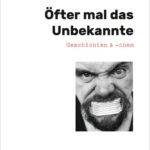
Buch »Öfter mal das Unbekannte – Geschichten und -chen« erscheint voraussichtlich im November 2025
Zu Bestellen beim Herrn Scherl über www.facebook.com/thomas.scherl.7