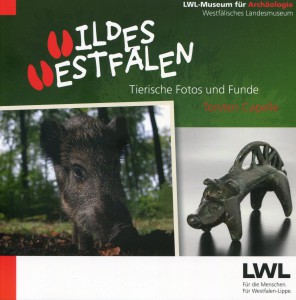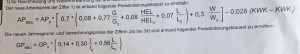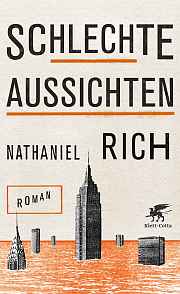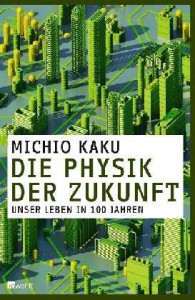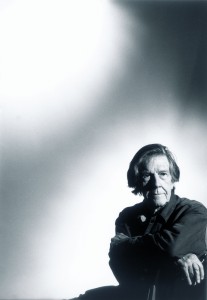Manchmal liegt die Fachwelt krass daneben: Herner Museum zeigt „Irrtümer und Fälschungen der Archäologie“

Humorvoller Einstieg ins Irrtums-Thema: David Macaulay mit einer seiner Zeichnungen, die Funde wie Toilettenbrille und Deckel – Jahrtausende später – als edlen Schmuck deuten. (Foto: LWL / S. Brentführer)
Ein Ausstellungstitel im Klartext-Modus: „Irrtümer und Fälschungen der Archäologie“ nimmt in Herne selbstkritisch die eigene Zunft aufs Korn. Schauplatz ist das LWL-Museum* für Archäologie, das den detektivischen Spürsinn des Publikums weckt. „Fakt oder Fake?“, das ist auch hier die Frage. Klingt irgendwie ziemlich aktuell.
Zu Beginn richten sich phantasievolle Blicke in die Zukunft. Bereits 1979 hat der US-Architekt und Zeichner David Macaulay den Bildband „Motel der Mysterien“ veröffentlicht. Das Buch handelt von einer fiktiven Ausgrabung im Jahr 4022 n. Chr., die für diese Ausstellung teilweise nachinszeniert wurde. Unser ferner Nachfahre, der Hobby-Archäologe Howard Carson, deutet demnach billiges Plastik als ungemein kostbares Material, eine Toilettenbrille als edlen Halsschmuck und eine Kloschüssel als Trichter, durch den wohl Gottheiten angerufen wurden. Rätselhafte „Yankee-Kultur“…

In Wahrheit keine Krone, sondern Beschlag eines Eimers: Rekonstruktion des Xantener Grabfundes nach Philipp Houben und Franz Fiedler, 1839. (Foto: Bayerische Staatsbibliothek)
Solche krassen Fehldeutungen sind, wie wir im weiteren Verlauf des Rundgangs erfahren, auch in der wirklichen Archäologie vorgekommen. Museumsdirektor Josef Mühlenbrock zitiert dazu den Reim: „Was man nicht erklären kann, sieht man stets als kultisch an.“ Heute verfügen die Experten freilich über so viele Vergleichsstücke, dass sie nicht mehr so leicht getäuscht werden können. Doch so ganz ist niemand dagegen gefeit.
Die Reihe der Irrtümer und Fälschungen wird mit rund 200 Exponaten dokumentiert. Das Spektrum reicht von Heinrich Schliemann, der die Ausgrabungen in Troja fast nur im Lichte der Homer-Dichtung „Ilias“ erklären wollte und damit gründlich daneben lag, bis hin zu Konrad Kujau, dem Fälscher der berüchtigten „Hitler-Tagebücher“.

Gar nicht antik: Der Goldschmied Israel Rouchomowsky schuf diese goldene Tiara gegen Ende des 19. Jahrhunderts. (© bpk/RMN – Grand Palais, Foto Hervé Lewandowski)
Ein Beispiel, das Macaulays Phantasien ähnelt: 1838 stieß der Freizeit-Archäologe Philipp Houben in Xanten auf ein frühmittelalterliches Grab und fand darin einen vermeintlich gekrönten Schädel. Doch die Krone, so stellte sich später heraus, ist in Wahrheit die Einfassung eines Holzeimers gewesen.
Der Pariser Louvre fiel 1896 auf die geschickte Fälschung einer angeblichen „Tiara des Saitaphernes“ herein und kaufte den goldenen Helm voreilig. Urheber des Objekts war allerdings ein Zeitgenosse, nämlich ein begabter Goldschmied aus Odessa. Der Louvre hat jetzt die Fälschung nach Herne ausgeliehen. Längst gilt der einst so peinliche Irrtum als historisches Lehrstück.
Ein weiterer Erzählstrang der Schau rankt sich ums sagenhafte Einhorn. Frühere Forscher-Generationen waren von der Existenz des Fabeltiers überzeugt, so auch Koryphäen wie Otto von Guericke, u. a. Erfinder der Luftpumpe. Ihm galt ein Knochenfund von 1663 in Quedlinburg (Harz) als Einhorn-Beweis. Sogar der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz übernahm eine entsprechende Skelettzeichnung in seine „Protogaea“, ein Standardwerk über Fossilien. Herne zeigt dazu die originale Kupferstichplatte und ein imposantes Modellskelett.

Rekonstruktions-Zeichnung des „Quedlinburger Einhorns“ in Gottfried Wilhelm Leibniz‘ Buch „Protogaea“ (1749). (Foto: LWL)
Die westfälische Region kommt auch vor. Das Herner Archäologie-Museum selbst ist 2003 beinahe dem Hype um einen „Paderborner Schädel“ aufgesessen, der angeblich Relikt eines 27.000 Jahre alten „Ur-Westfalen“ gewesen sein sollte. Quasi in letzter Minute wurde verhindert, dass das Stück einen Ehrenplatz in der Dauerschau einnahm.
Geradezu komisch: Im nahen Herten tauchten im Jahr 1980 Fundstücke auf, die für steinzeitliche Feuersteine gehalten wurden. Nichts da! Der Fund ging letztlich auf den Marketing-Gag eines örtlichen Wurstfabrikanten zurück.
„Irrtümer und Fälschungen der Archäologie“. LWL-Museum für Archäologie, Herne, Europaplatz 1. Bis zum 9. September 2018, geöffnet Di/Mi/Fr 9-17, Do 9-19, Sa/So 11-18 Uhr. Katalog 29,90 Euro. Außerdem: Bildband „Motel der Mysterien“ von David Macaulay 19,90 Euro. Weitere Infos: http://www.irrtuemer-ausstellung.lwl.org oder www.lwl-landesmuseum-herne.de
Nach der Station Herne wird die Ausstellung noch im Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum zu sehen sein (24. November 2018 bis 26. Mai 2019).
* Für Auswärtige: LWL bedeutet Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Sitz Münster)