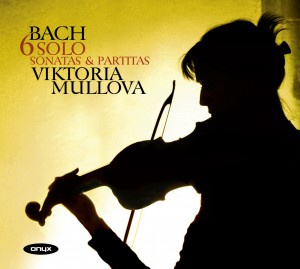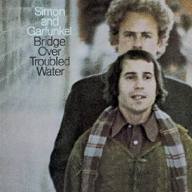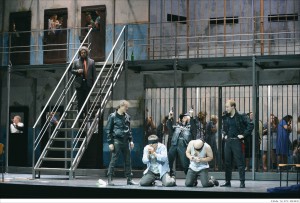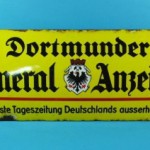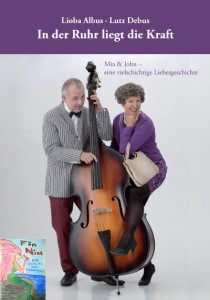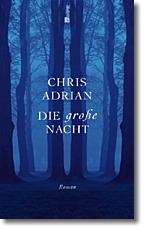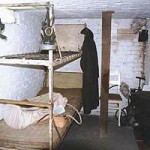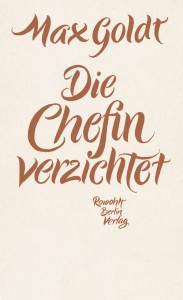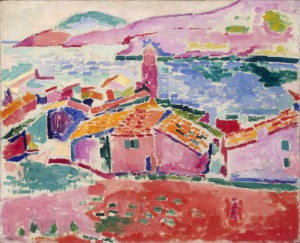Mustertafel mit „Mannequins“ für den Künstlerbedarf (Detail), französisch, um 1868, Sammlung Dietmar Siegert. Foto: Matthias Kampmann
Monsieur Leblonde kann man sich vorstellen als jemanden, der von Atelier zu Atelier zog und ein interessantes Produkt anpries: eine Puppe aus Kautschuk. An sich nichts Besonderes, aber zu der Zeit, es ist das 19. Jahrhundert, ein herrliches Utensil für halsstarrige Akademisten, die sich von der Fotografie nicht den Schneid abkaufen lassen wollten und natürlicher als die Natur zu malen gedachten.
Diese Puppe ist aus heutiger Sicht mehr als nur ein Symptom für die Geschäftstüchtigkeit eines Bildhauers mit Nebeneinkünften. Sie ist Symbol einer Zeit, in der Golems, Homunkuli und Roboterfantasien geträumt wurden. Das Doppel des Menschen. Hier in Form eines Lehrmittels. Leblonde führte nun nicht das vielfach ausgezeichnete Modell mit sich. Vielmehr besaß er einen Klappkoffer aus zwei Holzrahmen. In voller Ausbreitung mannshoch, zeigt es herrlich posierend diese Erfindung zur Erkundung der menschlichen Anatomie in zahlreichen Fotografien, und man muss schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich um einen künstlichen Körper handelt.
Vielleicht ist es das überraschendste Exponat in der Ausstellung „Tagträume – Nachtgedanken. Phantasie und Phantastik in Graphik und Photographie“, die Yasmin Doosry, Direktorin der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg, zusammen getragen hat. Wieder einmal geht es um die Phantasmen, wieder einmal um die Relation der Surrealisten zu kunsthistorischen Vorläufern seit der Dürerzeit.
Nur Papier. Die trockene Feststellung ist keine Geringschätzung. Doosry beschreibt, dass gerade die Grafik Ideenschmiede der Künstler war. Rund 130 Fotografien, Zeichnungen, Druckgrafiken und Künstlerbücher sind in der Ausstellung zu sehen, die in Kooperation mit der Fundación Juan March, Madrid, entstand. Davon stammen 80 Prozent aus dem Bestand des Nürnberger Instituts. „Gut, dass unser Museum ein solches Depot hat. Sonst wären solche Ausstellungen nicht möglich“, meint Ulrich Großmann, Generaldirektor des Hauses.
Und in der Tat. Man sieht, hier wird aus dem Vollen geschöpft, und die Qualität der heimischen Arbeiten ergänzen prominente Leihgebern wie das Pariser Centre Pompidou. Es ist einfach wunderbar. Frisch wie am ersten Tag der Totentanz von Michael Wolgemut aus dem Jahr 1493 oder die „Majuskeln des lateinischen Alphabets“ von Matthias Zündt nach Hans Lencker von 1567, ein koloriertes und mit Gold gehöhtes Titelblatt von Lenckers „Perspectiva Literaria“.
Die Ausstellung, typisch für Grafikabteilungen, liegt im Halbdämmer. Das kommt nicht nur der Physis der empfindlichen Arbeiten wie den geradezu hingehauchten „Geschlossenen Augen“ eines Odilon Redon, eine Lithografie von 1890, zugute, sondern steigert auch die Einstimmung aufs Thema. Elf Kapitel beleuchten das Unheimliche, Fantastische, Träumerische in der Kunst seit der deutschen Renaissance. In den Vitrinen haben die Ausstellungsdesigner stumpfe Spiegel – gespenstisch – simuliert.
Der Besucher betritt jedoch keine mit Spinnweben vergarnte Rumpelkammer, sondern eine wohl sortierte und geordnete Melange aus kühler Geometrie mit ein bisschen Schreckenskabinett, Suchbildern und desorientierender Verwirrmaschine. Das Menschliche wird durch seltsame Konstrukte aus Torsi und Konfrontationen mit allerlei Fremdkörpern übersteigert. Fühlbar und sichtbar ist Entfremdung durch Verfremdung. Physikalisch simpel kommen noch die Anamorphosen daher, die seit dem 16. Jahrhundert entstehen und mehr oder weniger andeuten, dass das Sehen immer ein vermitteltes ist.
Es braucht den täuschenden Rundspiegel, damit das Bild von Diana und Cupido, die den schlafenden Endymion aufsuchen, unverzerrt gesehen werden kann. Christian Heinrich Weng kreierte das Rundblatt um 1770. Motivisch organisiert Doosry André Steiners „Anamorphose III“ (1933) aus der höchst qualitätsvollen Sammlung von Dietmar Siegert, der fast alle Fotografien beisteuerte, hinzu. Das Gummiband im Bild mit der schrägen Perspektive soll der Ariadnefaden sein, doch der Blick bietet keine Übersicht, das Auge dreht Schleifen zwischen Vordergrund und dem Spiegelbild im Hintergrund. Oder ist es umgekehrt?

Christian Heinrich Weng: Diana und Cupido suchen den schlafenden Endymion auf, ca. 1770. Foto: Matthias Kampmann
Es gibt in der Schau Exponate, die einfach Freude bereiten, selbst wenn ihr künstlerischer Wert weniger bedeutend ist. So bietet sich hier für viele Menschen vielleicht das erste Mal die Gelegenheit, einen originalen „Cadavre exquis“ zu betrachten. Dieser hier stammt aus dem Jahr 1935. Mitgewirkt haben Óscar Domínguez, Hans Bellmer, Georges Hugnet und Marcel Jean. Mit Blei- und Farbstiften zeichneten sie auf das einen halben Meter lange und 32,8 Zentimeter breite Papier. Jeder beackerte einen Teil des Blatts, den die anderen jedoch nicht sehen konnten. Dann falteten sie den Streifen, und der nächste war dran. Wer dabei was gezeichnet hat, lässt sich nur mutmaßen. Auseinandergefaltet ergibt sich das verrückte Erzeugnis.
Das Erstellen des Cadavre ist eine Form gemeinschaftlicher Kreativität, die immer zu überraschenden Ergebnissen führt. Hier stoßen Schriftwolken mit den Künstlernamen auf Formen, die wie Organe anmuten, und die ganze absurde Zeichnung wächst aus einem Vulkan, der sich aus einer ovalen Blase speist. Erotische Konnotationen erwünscht. Aber das ist ja so üblich bei den Surrealisten. Schließlich atmeten ihre Helden Siegmund Freud und entließen ihre Einfälle durch die „Steigrohre des Unbewussten“.
Es ist definitiv nichts Neues, den Surrealismus in eine verwandtschaftliche Beziehung mit früheren Künstlern zu setzen. Kuratorin Doosry bezieht sich hier ganz bewusst auf die 1937 im New Yorker Museum of Modern Art gezeigte Surrealisten-Schau, in der der legendäre Gründer Alfred Barr eine solche Kombination erstmals realisierte. Der Blick auf die Fantastik durch die Brille des Surrealismus ist ja so naheliegend, dass derzeit auch eine Ausstellung des Frankfurter Städelmuseums mit „Schwarze Romantik“ einen ähnlichen Fokus setzt. Allerdings ist es in Nürnberg ausschließlich Grafik in Kombination mit der Fotografie, die zu motivischen und inhaltlichen Vergleichen anregt.
Das Nürnberger Vorhaben bleibt bei der Kunst und begeht nicht den Fehler, der in den 90er Jahren Methode war, Kunstgeschichte als psychoanalytisch motivierte Theorie-Illustration zu betreiben. Hier bleibt man auf dem Teppich. Abheben sollen andere. Sehr schön ist etwa die Kombination der Rötelzeichnung „Eine Art zu fliegen“ von Francisco de Goya mit der gleichnamigen Radierung, veröffentlicht nach dem Tod 1864 als eine der 18 „Torheiten“, damals unter dem Titel „Sprichwörter“. Was dieser seltsame Otto Lilienthal und seine Mitflieger in Vogelflug imitierenden Apparaten da machen, entzieht sich zum Glück der finalen Deutung – wie das meiste in dieser Ausstellung.
Es öffnen sich zudem andere, ungedachte Fenster, die leider in der Schau keine Berücksichtigung finden. Yasmin Doosry erzählt, dass „Aqua“, eine Arcimboldo nachempfundene Kompositfigur aus Meerestieren von 1580 aus dem Nachlass von Vincent Van Gogh stammt. Von dem sicher das eine oder andere Fantastische hätte gezeigt werden können. An sich ist es eine durchaus attraktive Vorstellung von einer vielleicht fantastischen Ausstellung. Und dass ein Museum seine eigenen Grenzen überschreitet und wie im Fall des Germanischen Nationalmuseums ausnahmsweise nicht nur Kunst aus dem deutschsprachigen Raum zeigt, ist angesichts des Themas notwendig.
Doch natürlich trifft man in der Hauptsache die üblichen Verdächtigen. Salvadore Dalí, Max Ernst, Paul Klee, Pablo Picasso, Man Ray, Yves Tanguy, bei den Älteren dann Giovanni Battista Piranesi, Goya, und natürlich kann eine solche Ausstellung an diesem Ort „nicht ganz Dürer-frei“ bleiben, wie Generaldirektor Ulrich Großmann trocken feststellt. Vom übermächtigen Altmeister ist einmal mehr die „Melancolia I“, der unglaublich berühmte wie rätselhafte Kupferstich aus dem Jahr 1514 zu sehen. In jedem Fall bekommen die Besucher eine Menge zu tun, eine weite Übersicht und viele motivische Bezüge vom Auftakt mit dem Blick des inneren Auges über die weiteren zehn Stationen. Wer wollte sich dem widersetzen.
Die Ausstellung ist vom 25. Oktober bis 3. Februar 2013 zu sehen. Öffnungszeiten: Di, Do, So 10 bis 18 Uhr, Mi 10 bis 21 Uhr. Der Katalog kostet 28,50 Euro im Museumsshop, im Buchhandel 38 Euro. Ein besonderes Highlight im Beiprogramm ist die Kooperation mit dem Filmhaus Nürnberg. Es werden dort unheimliche und fantastische Filme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, etwa „Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens“ (1922) von Friedrich Wilhelm Murnau, gezeigt (25.11., 19.15 Uhr).
 Vor Jahren verschlug es mich beruflich zur Bochumer Straße 96 in Wattenscheid, dessen glorreiche Tage innerer und äußerer Selbstständigkeit zwar offiziell längst gezählt sind, inoffiziell, also im Lebensalltag, jedoch nach wie vor zählen, weil die Wattenscheider eben nie Bochumer werden. Und das ist gut so!
Vor Jahren verschlug es mich beruflich zur Bochumer Straße 96 in Wattenscheid, dessen glorreiche Tage innerer und äußerer Selbstständigkeit zwar offiziell längst gezählt sind, inoffiziell, also im Lebensalltag, jedoch nach wie vor zählen, weil die Wattenscheider eben nie Bochumer werden. Und das ist gut so!