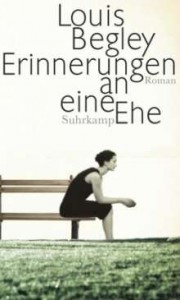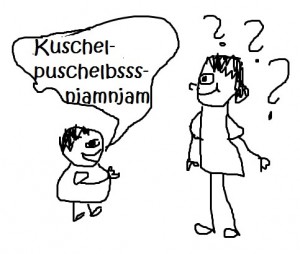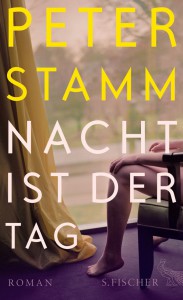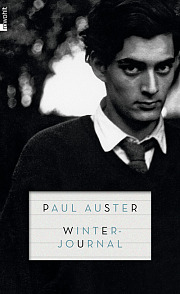Gun-Brit Barkmin als Lady Macbeth in Essen. Foto: Matthias Jung
Ein kleiner Erdhügel zu den gläsernen punktierten Zweiunddreißigsteln des Vorspiels von Verdis „Macbeth“. Ein Grab. Zwei Menschen nähern sich ihm, Lilien in den Händen. Der Fortissimo-Sturm der scharf akzentuierten Bläser bricht los. Unter der Bühne kracht und knallt es; ein riesiger Baum reißt sich los, kämpft sich hinauf in den dunklen Himmel, als starte ein monströses Raumschiff. Die Wurzeln triefen zu Boden – dorthin, wo sich ein kreisrunder Schlund geöffnet hat.
Mit einem spektakulären Bild werden die Zuschauer im Essener Aalto-Theater von Bühnenbildner Christof Hetzer in Verdis abgründige Tragödie hineingestoßen. Baum und Grab – Symbole für Leben und Tod – bilden die zentralen Motive der Bühne; Abgrund und Brücke treten dazu: Hetzer baut über den manchmal schwarz starrenden, manchmal trüb beleuchteten Krater einen Steg wie aus einem jener schwarzweißen, gruseligen Gothic-Krimis, in denen sich das Abgründig-Menschliche und das Unheimlich-Übernatürliche auf geheimnisvolle Weise verbinden.
Herbstblätter bedecken die weite Fläche der Bühne. Ein riesiger Raum, in dem die Figuren oft verloren wirken – wie hinausgeworfen in eine Welt in Dunkelheit oder Zwielicht, in der sie keine Orientierung finden. Nur die Gräber sind Bezugspunkte: ein erdiges Kindergrab und ein alter Sarkophag aus rissig-moosigem Stein. Dorthin werden die Toten gekippt. Dort stirbt Macbeth, noch lebend schon im Grabe, mit seinen letzten Worten die Krone von sich werfend.

Kinderlosigkeit löst den blutigen Machttrieb aus: Tommi Hakala am Grab. Ein gestorbenes oder nie geborenes Kind? Foto: Matthias Jung
Das Motiv der lebenden Toten ist auch für David Hermann in seiner Inszenierung ein entscheidendes: Wenn der König die Schotten für jenes fatale Fest versammelt, auf dem ihn der Geist des ermordeten Banco in Angst und Wut entrückt, scheint er längst selbst zum Totenreich zu gehören: Er spricht mit den Ermordeten, die wie lebensgroße Marionetten auf dem Sarkophag hocken, lässt sie wie Handpuppen sprechen und nicken, echauffiert sich, als eine der Gestalten zusammenklappt. Ein grotesk-makabres Theater, von dem die Menschen um ihn herum keine Notiz nehmen. Wie bei einem Picknick in Glyndebourne sitzen sie im Herbstlaub, speisen aus geflochtenen Körben, lassen sich von Macbeth ohne Reaktion die Weinflasche wegnehmen. Mit der realen Welt hat das mörderische Königspaar nichts mehr zu tun – es ist längst in seine eigene Horrorwelt hineingestorben.
Das ist alles sehr klug, sehr konsequent und sehr detailreich erfunden – und lässt dennoch auf seltsame Weise unberührt. Vielleicht, weil uns diese Wiedergänger-Geschichte nicht interessiert. Weil die Spannung zwischen der Welt der Lebenden und der Toten im allumfassend leblosen Raum aufgelöst wird. Weil der humane und der politische Aspekt des Stücks wegsymbolisiert, wegpsychologisiert wird. Oder auch, formal argumentiert, dem spektakulären Baumstart zu Beginn szenisch nicht mehr viel folgt.

Ein riesiger Baum reißt sich los, kämpft sich hinauf in den dunklen Himmel. Foto Matthias Jung
Die Hexenchöre schallen aus der unbestimmten Dunkelheit; die Erscheinungen im dritten Akt sind ein beziehungsreicher, aber szenisch läppisch gelöster Aufmarsch schwangerer Frauen. Das Bild des leidenden Volkes zu Beginn des vierten Aktes – der Chor schiebt sich durch den Zuschauerraum nach vorne – bleibt stumpf; die blutigen Kinderleichen um den Sarkophag auf der Bühne wirken dazu wie ein zu billig geratener Schockeffekt. Auch die zwei Zeit-Ebenen, durch Hetzers Kostüme gekennzeichnet, helfen nicht wirklich weiter.
So spitzt sich das Drama nicht zu, sondern verläuft sich eher in den Bildern. Ein Grund mag sein, dass Hermann mehr auf die sorgfältig gesetzten symbolischen Gesten setzt als auf eine sprechende Personenführung. Der glänzende Handschuh, den Macbeth vom Arm des toten Duncan streift – ist es „la man rapace“, die „räuberische Hand“, die er gegen seine erklärte Absicht dann doch erhebt? Wenn Macbeth den toten Banco mit einer Lilie peitscht – ist es eine Chiffre für den verzweifelten Hass auf den Mann, der Kinder hat? Kleine Jungs in Anzügen plagen den König – sind es die drohenden Nachkommen Bancos?
Die Videos von Martin Eidenberger, projiziert auf den massiven Mauerwürfel, der sich einige Male über die Szene senkt, schaffen in der Hexenszene des dritten Akts eine deutende Bild-Ebene, sind aber an anderer Stelle aber banal: eine rote Hand etwa, oder kaleidoskopartige Muster. Wir sehen eine Inszenierung, die das Stück nicht verschenkt, die viel Reflexion und Dramaturgen-Subtext integriert, aber als Theater die Spannung nicht hält, die Aufmerksamkeit nicht durchgehend fesseln kann. Kein missglückter, aber auch kein rundum überzeugender Auftakt der neuen Ära am Aalto-Theater.

Einstand mit „Macbeth“: Tomás Netopil, der neue Chefdirigent der Essener Philharmoniker. Foto: TUP
Mit Spannung erwartet wurde den Einstand des neuen GMD Tomáš Netopil in der Oper: Kurz gesagt, war es ein glückliches Debut. Netopil bewies, was sich bereits in Verdis „Missa da Requiem“ im Sinfoniekonzert angekündigt hatte: Er hat die Sensibilität für Verdis musikalisch-dramatische Orchestersprache, für den klugen Aufbau dynamischer Großstrukturen, für das behutsam ausgeformte Detail, für die rhythmische Prägnanz und den erfüllten Duktus der Melodie. Dem Finale des Ersten Akts etwa gibt er den agogisch gestalteten, inneren rhythmischen Drang, der sich in der sicher angesteuerten Entladung befreit.
Die Philharmoniker lassen kaum etwas zu wünschen übrig, sind auf dem Punkt, wenn es um die Einfärbung des Klangs durch gekonnte Balance der Instrumente geht, um die Schärfe punktierter Rhythmen oder den wuchtigen Tutti-Zugriff, gestützt von prachtvollen Blechbläsern. Was sich noch entwickeln muss, sind die Finessen des Ausdrucks: Die „tinta“, die Verdi haben will, jene im Falle des „Macbeth“ dunkel verschattete Orchesterfarbe, die fahlen Klänge, die erstickten, halb unterdrückten Laute, die unwirklichen, atmosphärisch entrückten Momente, bleiben bei Netopil noch zu neutral. Und im Vorspiel schlittert er aus einer zu stark angezogenen Bewegung in ein nicht unheimlich-majestätisches, sondern schleppend langsames Tempo. Auch die kruden Striche waren überflüssig und ärgerlich: So etwas sollte sich Netopil gleich gar nicht angewöhnen.
Eine reife Leistung darf man Alexander Eberles Chor attestieren: Tönten die Hexenchöre anfangs zu lyrisch-brav aus dem Off, entwickelte sich der Klang ab dem Sextett mit Chor zu prachtvoller Größe. Die Solisten geben dagegen nicht nur Anlass zum Glücklichsein. Gun-Brit Barkmin als Lady wird mit den Anforderungen ihrer Riesenpartie in punkto Beweglichkeit und psychologischer Differenzierung anstandslos fertig. Aber die Stimmfarbe ist sehr hell und schwer zu verschatten. Ihre Piano-Skala lässt sich weit auffächern, aber das hohe b, mit dem sie im Sextett über den Chor kommt, klingt gellend und scharf. Außerdem neigt Barkmin dazu, in die Sprechstimme zu wechseln, nähert sich veristischen Ausdrucksmitteln, die sie auch in ihrer Wahnsinnsszene einsetzt, statt mit der Stimmfarbe zu spielen.
Auch der Macbeth des finnischen Baritons Tommi Hakala flattert unzureichend gestützt, wird immer wieder in der Höhe eng, verliert den Kern des Klanges. Doch in der finalen Szene, als Macbeth allen Sinns verlustig mit seiner Krone auch sein Leben wegwirft, läuft Hakala zu großer Form auf: Diesem unterdrückten, stammelnden Absterben des Tones, das Verdi in seinem höchst expressiven Schluss des „Macbeth“-Ursprungsfassung von 1847 fordert, entspricht der Sänger voll und ganz. Hätte er nur für die kantablen Szenen dieselbe Solidität. Aber dort, wo sichere Technik gefragt ist, kommt Hakala ins Schwimmen.
Für Alexey Sayapin, neues Ensemblemitglied, als Macduff gilt das nicht. Er demonstriert in seiner Arie eine versierte Beherrschung seines Tenors – die ihm in den dünn gequäkten Tönen des Finales wieder fehlt. Was Sayapin nicht hat, ist der flutende, freie Klang, der den traditionell geschulten, heute selten gewordenen italienischen Tenor auszeichnet. Die Stimme sitzt zu fest, der Klang wird nicht entspannt gebildet.
Ein Gewinn für Essen ist der Bass Liang Li: Eine voluminöse, aber beherrschte Stimme, reich an Farben und fähig, sie auch flexibel einzusetzen; ein meist kontrolliertes Vibrato und eine schmelzende Legato-Linie. Ein mustergültiger Banco. Marie-Helen Joël bewährt sich erneut erfreulich als Kammerfrau der Lady, die von Macbeth ebenso gemeuchelt wird, ebenso wie der in seinen wenigen Sätzen schönstimmige Arzt (Baurzhan Anderzhanov). Abdellah Lasri kann als Malcolm problemlos Tenor-Paroli bieten. Die erste Premiere unter Intendant Hein Mulders ist mehr als ein Versprechen, noch nicht ganz eine Erfüllung, signalisiert aber den Elan, mit dem sich das neue Team am Aalto die Zukunft erobern will. Nur zu!