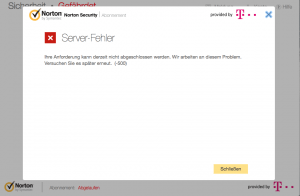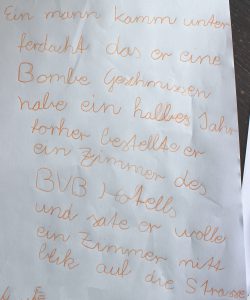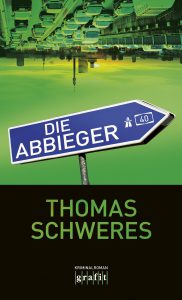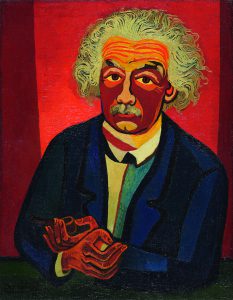Wenn 60 Schriftsteller durch die Dortmunder Nordstadt gehen

Schriftsteller Heinrich Peuckmann (frontal, Mitte) im Kreise von Autorenkolleg(inn)en auf dem Weg zur Dortmunder Nordstadt. (Foto: Bernd Berke)
Freunde, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man hier so sagt: Der Autorenverband PEN hat heute auf seiner Dortmunder Jahrestagung mit Regula Venske nicht nur eine neue Präsidentin gewählt, sondern u. a. auch eine Resolution gegen die konfuse Rechtsausleger-Partei AfD verabschiedet. Morgen (Samstag) soll es um die betrübliche Lage in der Türkei gehen. Das alles ist richtig und wichtig. Jedoch…
Das „wirklich wahre Leben“ (wie es bei „Dittsche“ so schön heißt) spielt sich teilweise woanders ab als im Tagungssaal. Beispielsweise in der nicht gerade bestens beleumundeten Dortmunder Nordstadt, die den überregionalen Medien oft als prototypisches Gelände für soziale Schauergeschichten aus dem Revier dient.
Eine verrufene Gegend
Also war es im Prinzip eine gute Idee des Schriftstellers Heinrich Peuckmann (Dortmund/Kamen), für interessierte Autorenkolleg(inn)en einen Gang durch diesen Stadtteil zu organisieren, den manche gar als No-Go-Area verunglimpfen, man lese dazu etwa diesen Text aus der FAZ. Nicht nur die Polizei hat auf diesem Areal zuweilen ihre liebe Not. Und so hatte vor Tagen schon Dortmunds OB Ullrich Sierau gescherzt, wenn man auf dem Gang die Hälfte aller Teilnehmer ans Ziel bringe, sei es schon gut gelaufen…
Nun aber mal halblang: Die Strecke des gar nicht so erschröcklichen „Spaziergangs“ führte vom Tagungsort, dem Kulturzentrum „Dortmunder U“, in eine weitere Kulturstätte, das „Depot“ in der Immermannstraße. Kurt Eichler, Leiter der Dortmunder Kulturbetriebe, machte den kundigen „Bärenführer“. Hinterdrein trottete eine immerhin rund 50 bis 60 Menschen starke Autorinnen- und Autorenschar. Angesichts einer solchen Ballung von auf längere Sicht Publizierenden kam ich mir als Schreiber des Tages schon beinahe etwas seltsam vor. Sei’s drum. Da muss man durch, woll?
„Lauter Deutsche“ auf der Strecke
Nordstadt ist nicht gleich Nordstadt. Wirklich verrufen sind bestimmte Straßenzüge. Freilich hat Kurt Eichler recht, der sagte, dass Dortmunder Bürger, die sich für gediegen halten, den Fuß schon seit jeher generell nicht in Gebiete nördlich des Hauptbahnhofs setzen. Er wusste auch von unermüdlichen Versuchen seit den 1970er Jahren zu berichten, der Nordstadt etwas Kultur und etwas Grün angedeihen zu lassen. Es begann mit Mitteln des Städtebaus, nicht mit der eigentlichen Kulturförderung. Die Erfolge sind begrenzt.
Nun ist es ein gar eigenes Ding, mit geschätzt 60 Leuten durch soziale Brennpunkte zu stiefeln, wobei man überdies die ärgsten Ecken links oder rechts liegen ließ. Welch eine Exotengruppe! Ich hab’s nicht mit eigenen Ohren gehört, aber hernach hieß es, ein paar Jugendliche hätten sich am Wegesrand gewundert, dass da ja „lauter Deutsche“ auf Tour seien. Hätten sie noch gewusst, dass es sich fast durchweg um arrivierte Bücherschreiber gehandelt hat, so wäre des Staunens kein Ende mehr gewesen. Ob sich jemand aus der literarischen Gruppe nun animiert fühlt, einige Seiten über Dortmund zu schreiben? Man darf es bezweifeln.
Mich hat die Aktion ganz vage an ein Erlebnis am Ende der 80er Jahre erinnert. Damals waren wir – im Gefolge des damaligen NRW-Kultusministers Hans Schwier – als Journalisten-Tross in New York unterwegs. Zum Programm gehörte eine Führung durch die Bronx, die damals wahrhaftig eine No-Go-Area war. Ohne bewaffneten Polizeischutz ließ man uns nicht gehen.
Homöopathische Dosierung
Zurück nach Dortmund, wo es vergleichsweise herzlich harmlos zuging: Das wahre Flair der Nordstadt war auf diese Weise jedenfalls kaum zu spüren. Es kam allenfalls in stark verdünnter, gleichsam in homöopathischer Dosierung an, keineswegs als Essenz. Die Frauen und Männer des gepflegten Wortes hätten sich vielleicht allein oder zu zweit auf den Weg begeben müssen.
Auf dem langen Rückweg habe ich mir ein solches Erlebnis im Solo gegönnt. Kreuz und quer. Und was soll ich sagen: Hie und da scheint etwas in der Luft zu liegen, nicht in jedem Moment geht das Ganze völlig schwerelos vonstatten. Oder bildet man sich das alles – im Gefolge permanent aufgeregter Medien – nur ein? Es ist allemal eine Erfahrung. Ja, grinst nur!
Der kitzligste Augenblick des besagten Autorenausflugs war hingegen schon jener, in dem ein ungeduldiger BMW-Fahrer an der Ampel am liebsten gleich ein Dutzend Schriftsteller auf die Kühlerhaube genommen hätte, weil die nach seiner Ansicht nicht schnell genug die Kreuzung räumten. Rüpel, elender!
Auf den Spuren von Samuel Beckett
Was viele vorher nicht wussten: Wir wandelten „irgendwie“ auf den Spuren des großen Samuel Beckett. Wie Heinrich Peuckmann versicherte, habe Beckett in grauer Vorzeit eine Freundin in Kassel gehabt und sich auf der An- oder Abreise mitunter in der Dortmunder Nordstadt umgesehen. Rund um den Steinplatz gab’s damals etliche „Amüsier-Betriebe“. Davon inspiriert, habe der irische Weltliterat auch ein Gedicht über Dortmunder Bier verfasst. Peuckmann: „Das Bier fand ich allerdings besser als das Gedicht.“ Wer weiß: Am Ende ist selbst Becketts legendäres „Warten auf Godot“ noch auf eine Dortmunder Anregung zurückzuführen.
Ob sich dazu noch mehr Substanzielles recherchieren ließe? Dortmunds Kulturdezernent Jörg Stüdemann soll, als er die Geschichte vernahm, schon scherzhaft (?) über eine Gedenktafel an geeigneter Stätte nachgedacht haben…