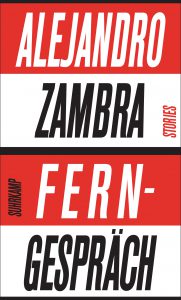Unser Gastautor, der Schriftsteller Heinrich Peuckmann, über eine prägende Gestalt der Reformationszeit:
Jedes Luthergedenkjahr zeigt uns nicht Luther, wie er war, sondern ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit. Nun also, zur 500. Wiederkehr des Thesenanschlags, der politisch korrekte Blick auf Luther, dessen Antijudaismus nicht verschwiegen oder beschönigt, sondern klar und als Makel herausgestellt wird. Immerhin.

Titelseite der Murner-Schrift „Von dem großen lutherischen Narren“ (Straßburg/Grüninger, 1522) (Public Domain/gemeinfreies Bild)
Das war zum 450. Geburtstag im November 1933 insofern anders, als die gerade an die Macht gekommenen Nazis sich in ihrem Antisemitismus auf Luther beriefen und ihn für seine Haltung lobten. Und ein Antijudaist (diese Bezeichnung zieht die Forschung dem Begriff Antisemit, was gleichbedeutend mit Rassist wäre, vor) war Luther ganz gewiss. Er stand damit in einer erkennbaren Tradition seiner Kirche, aber es stimmt nicht, dass seine Haltung aus diesem Faktum und dem Zeitgeist heraus erklärbar, schon gar nicht entschuldbar wäre. Es gab genügend Theologen (Bernhard von Clairvaux), die anders dachten, die Juden verteidigten und Pogrome verurteilten.
Antijudaische Schriften
Luthers Schrift „Jesus Christus ein geborener Jud“ verfolgte denn auch nicht die Absicht, die Wurzel des Christentums aus dem Judentum heraus aufzuzeigen und damit dem Antijudaismus jegliche Grundlage zu entziehen. Es war im Gegenteil eine an die Juden gewandte Schrift, damit sie endlich die Messianität Jesu anerkannten. Als sie das nicht taten, war Luther umso enttäuschter und wurde umso drastischer in seinen Formulierungen.
Dieser Aspekt wird nun von der Kirche offen dargestellt, etwas anderes ist auch nicht mehr möglich. Ein anderer, spannender Aspekt taucht bisher noch viel zu wenig auf, nämlich die lebhafte Publizistik zur Zeit der Reformation, vor allem auf lutherischer Seite, dem aber auf katholischer Seite ein Franziskaner, nämlich Thomas Murner, als gleichwertig gegenüber gesetzt werden kann. Auch an ihn sollte in diesem Jubiläumsjahr unbedingt erinnert werden.
Blüte des Buchdrucks und neue Debattenkultur
Die damals herrschende Stellung der Kirche wird durch die reformatorische Publizistik erschüttert, bisweilen sogar an den Rand gedrängt. Die Kirche des Mittelalters vertrat noch die Position des abgestuften Wissens, sie unterschied streng zwischen Geistlichen und Laien und beschränkte die theologische Diskussion auf den Kreis der Geistlichen.
Luther folgte diesem Denken anfangs, daher die Abfassung seiner 95 Thesen in lateinischer Sprache. Aber dabei blieb es nicht. Das Aufblühen des Buchdrucks eröffnete neue Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Spätmittelalterliche Formen der Predigt und Literatur verbanden sich mit reformatorischen Inhalten und wirkten so auf die Massen, die wiederum in die Diskussion eingriffen. Dialoge wurden geschrieben und publiziert, Satiren und Parodien in teilweise erbitterter Schärfe und Polemik. Eben an Massen gerichtet und daher massenwirksam. Es fand, wenn man so will, eine Demokratisierung der Debattenkultur statt.
Die Gefahr der Kirchenspaltung
Die katholische Kirche tat sich noch lange schwer mit dieser Umstellung, aber einen, der es der reformatorischen Seite gleichtat, der die neuen Möglichkeiten ebenfalls nutzte und ihr in seinem wichtigsten Werk „Vom großen lutherischen Narren“ ebenbürtig war, hatte sie eben doch. Das war Thomas Murner.

Thomas Murner, „Cantzler der geuchmatt(en)“ (Kanzler der Gauchmatte), Holzschnitt von Ambrosius Holbein, Basel 1519 (Public Domain/gemeinfreies Bild)
Er wurde 1475 in Oberehnheim, heute Obernai in Frankreich, geboren, besuchte im nahen Straßburg eine Klosterschule und trat mit 15 Jahren dem Franziskanerorden bei. An verschiedenen Universitäten studierte er Philosophie, Theologie und Jurisprudenz, promovierte zum Magister der freien Künste in Freiburg und Doktor der Theologie in Krakau. Mit 22 Jahren wurde er zum Priester geweiht.
Ab 1512 erschienen seine ersten Hauptwerke, unter anderem „Die Narrenbeschwörung“, „Der Geuchmatt“ (eine Wiese der Lüstlinge – Worterklärung im Grimmschen Wörterbuch) usw., in denen er Missstände des feudalen Systems, aber auch der Kirche anprangerte. Murner war also kein betriebsblinder Verteidiger des alten Glaubens, im Gegenteil, er sah die Gefahr, in der sich eine Kirche befand, die losgelöst von den Problemen der Menschen agierte. Auch er wollte Reformen, aber er wollte eines nicht, nämlich die Spaltung.
Als dann Luther mit seinen Thesen kam, erkannte Murner schon früh diese Gefahr einer Spaltung, die die katholischen Würdenträger noch lange nicht sahen. Er bezog Stellung und nahm dafür in Kauf, was auch viele Reformatoren erdulden mussten, nämlich Verfolgung, Ausweisung, Schreibverbot und einmal, als Bauern seine Heimatstadt belagerten, Gefahr für sein Leben. Im letzten Augenblick gelang ihm die Flucht.
„Wie wohl er ganz daneben sticht…“
Schon 1522 erschien „Vom großen lutherischen Narren“. Die Schrift belegt, wie früh Murner die Gefahr für die Kirche erkannte, zu einer Zeit, als Luther wohl selber noch nicht die gesamten Folgen seines Thesenanschlags überschaute.
Zuerst ist Murner in seinem Umgang mit Luther noch sehr moderat. 1520 erschien seine Schrift „Christliche und briederliche ermanung an den hoch gelerten doctor Martino Luter“, in dem er „den herzallerliebsten Bruder in Christo“ bittet, von seinen Irrtümern abzulassen und sich wieder mit der Kirche zu vereinigen.
Luther nahm ihn anfangs nicht ernst, Murner war nur einer von vielen Gegnern. Aber als Murner nach Luthers Verbrennen der Bannandrohungsbulle „Exurge domine“ (Erhebe dich, Herr) mit einer wüsten Polemik, einer Glosse antwortet, nimmt auch Luther ihn zur Kenntnis und fügt in einer Verteidigungsschrift gegen einen anderen Gegner einen Anhang gegen Murner hinzu. Dabei zitiert er zum Schluss einen Reim, der ihm zugeschickt worden war:
„Doktor Murner, wie ich bericht
Hat aber ein Nacht geschlafen nicht
Zwei neuer büchlein zugericht
Darzu er sich fast hoch erbricht
Doctor Luthers Schriften anficht
Wie wohl er ganz daneben sticht …“
Das ging jetzt doch zu weit, das musste eine Antwort geben. Und sie kam in Form des „Großen lutherischen Narren“, der alle erprobten und erfolgreichen Formen reformatorischer Schriften aufgriff, Satire, Glosse und vor allem wüste Polemik.
Murner greift das Narrenmotiv auf, ein weit verbreitetes Motiv, vor allem durch Sebastian Brants „Narrenschiff“ (1494). Wenn Murner am Anfang seiner Schrift auch betont, dass er nicht Luther direkt angreifen wolle, sondern vor allem seine eigenen Gegner, die ausdauernd gegen ihn polemisiert hatten, so lässt er diese Absicht jedoch schnell fallen.
Am Ende geht es nur noch gegen Luther. Dessen Gegner, der ihn widerlegen und als gefährlich darstellen will, ist niemand anderer als Murner selbst, wodurch die Reformation auf Luther reduziert wird, die Angriffe gegen die katholische Kirche als Angriffe auf Murner wahrgenommen werden. Eine Personalisierung des Problems findet also in Murners Buch statt.
Ein Exorzist mit Katzenkopf
Im Mittelpunkt steht der große Narr, der durch Exorzismus beschworen werden muss. In ihm stecken viele andere Narren, die alle möglichen Aspekte der Reformation verkörpern, u.a. die Buntschuhgefahr, vor der Murner besonders warnte. Der beschworene „Großnarr“ gibt seine Geheimnisse anfangs nur unter Zwang preis, später wird er vertrauensselig und warnt seinen Beschwörer sogar vor den in ihm steckenden Narren. Der Exorzist, der mit Katzenkopf auftritt, hat ebenfalls keine einheitliche Haltung, mal ist er fürsorglich, mal zornig. Der Katzenkopf symbolisiert Murner selber, denn so haben ihn seine Gegner in ihren Pamphleten dargestellt, und indem er ihnen nun darin folgt, zeigt er eine gehörige Portion Selbstironie.
Es geht bunt zu in diesem Buch, Exorzismus, Hochzeit Murners mit Luthers Tochter, am Ende sterben sie, das müssen sie nach Murner auch, Luther und der große Narr. Und Luthers Leiche wird in einer Latrine versenkt, scheinheilig von vielen Katzen beweint, also, wenn man so will, von vielen kleinen „Murners“. Luther tot, Reformation entlarvt und vernichtet, das Buch schafft das, was in Wirklichkeit eben nicht gelingt.
Rücknahme der Sozialkritik
Etwas verbiegen musste sich Murner allerdings in seinem wichtigen Werk. Er hatte in früheren Schriften eine sozialkritische Tendenz verfolgt, hatte die Probleme der feudalen Gesellschaft durchaus gesehen. Nun kämpfte er für die alten Mächte. Da die Missstände jedoch offensichtlich waren, konnte er, um glaubwürdig zu bleiben, es sich nicht erlauben, die von den Reformatoren genannte Sozialkritik zu leugnen. Vielmehr versuchte er, sie zu bagatellisieren. Er kennzeichnet sie als perspektivlos und ohne sinnvolle Zielrichtung. Allenfalls, meint er, könne daraus eine Ordnung entstehen, in der die Reformatoren eigennützige Ziele verfolgen:
„Wir woln einmal auch selbs regieren,
wie das unß dunkt den buntschu schmieren
und haben einen guten mut
mit der reichen Kargen gut.“
Aus Veränderung könne nur Chaos entstehen, meint Murner, und davor warnt er.
Autor des Pamphlets auf der Flucht
Das Werk besteht aus 4800 Versen. Die Silbenzahl folgt nicht der strengen Form mit acht bis neun Silben, wie das etwa zeitgleich Hans Sachs tut, sondern der volkstümlichen Form des Sprechverses, dem es allein auf den Reim ankommt. Die Silbenzahl schwankt also zwischen sechs und elf Silben, ein alternierender Rhythmus wird weitgehend durchgehalten. Alles ist dem Inhalt untergeordnet.
Das Buch wurde schon kurz nach Erscheinen verboten, man begriff schnell seine Sprengkraft, und Murner erging es nicht gut. In Straßburg, das den reformatorischen Ideen zuneigte, durfte er sich nicht mehr sehen lassen, er musste nach Luzern ausweichen, wo er Aufnahme fand und nach neueren reformatorischen Streitigkeiten ebenfalls ausgeliefert werden sollte. Also erfolgte die nächste Flucht, bis er schließlich wieder in seinem Geburtsort ankam, wo er 1537 starb.
Wer 500 Jahre Reformation feiert, sollte auch an einen der profiliertesten Widersacher Luthers erinnern. Mit der Qualität seiner Gegner, das weiß man doch, wächst die eigene Bedeutung. Murner hatte Qualität, und dazu noch ein Schicksal, das er mit vielen Reformatoren teilte.