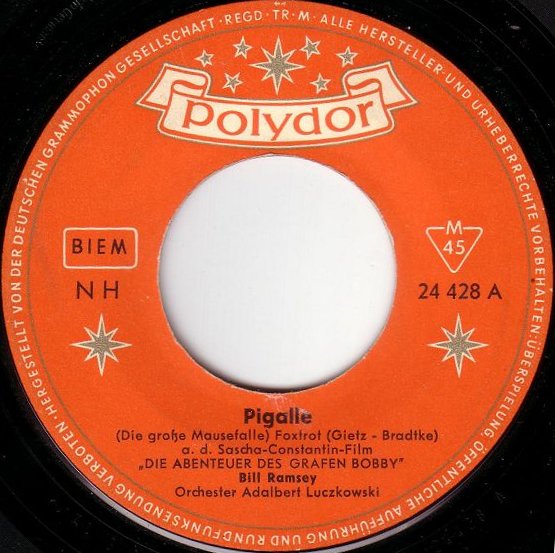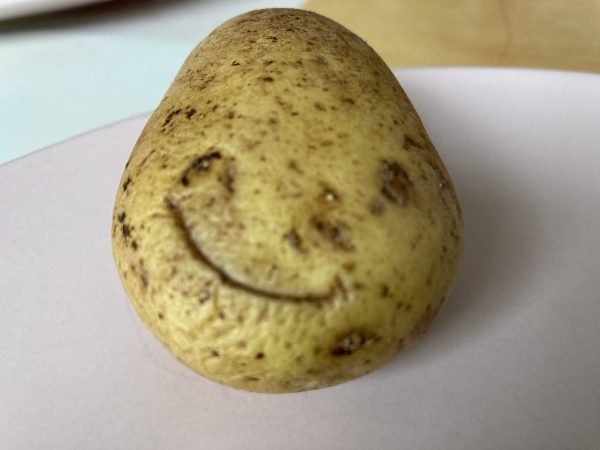Geistvoller Zaubertrank: „Le Philtre“ von Daniel François Esprit Auber wiederentdeckt

Konzertante moderne Erstaufführung von Aubers „Le Philtre“ im Kurtheater Bad Wildbad. Von Links: Emmanuel Franco, Luiza Fatyol, Patrick Kabongo. (Foto: Saskia Krebs)
Moment! Die Geschichte kommt uns bekannt vor: Ein einfacher Landarbeiter, ziemlich naiv, aber rührend seelenvoll, schmachtet für eine kapriziöse junge und begüterte Frau. Ein geheimnisvolles Elixier, verkauft von einem großmäuligen Quacksalber, bringt ihn auf die Sprünge, löst ihm die Zunge, aber ein schneidiger Soldat fährt ihm in die Parade. Am Ende kriegt er, was er ersehnt.
Das ist doch die nicht zuletzt wegen „Una furtiva lagrima“ beliebte Oper Gaetano Donizettis, die als „Elisir d’amore“ den Ruf des „Liebestranks“ in alle Ecken der musikalischen Welt verbreitet hat?
Stimmt – und stimmt doch nicht: Denn ein knappes Jahr vor der sensationellen Uraufführung von Donizettis Meistwerk ging im Juni 1831 in der Pariser Opéra „Le Philtre“ über die Bühne, eine von rund 45 Opern des geistvollen Franzosen Daniel François Esprit Auber. Dieser „Zaubertrank“ ist auf ein Libretto von Aubers zuverlässigem Stofflieferanten Eugène Scribe komponiert – eben jenes, das Felice Romani dann für Donizetti übersetzte und an die Gepflogenheiten des italienischen Opernbetriebs anpasste.
Obwohl Aubers „Le Philtre“ in Paris mit 243 Aufführungen bis 1862 ein beachtlicher Erfolg war, kam das Stück kaum über die Grenzen Frankreichs hinaus. Denn bereits Mitte der 1830er Jahre war Donizettis „Elisir d’amore“ international so verbreitet und beliebt, dass Auber keine Chance mehr hatte, sich durchzusetzen. Ein Schicksal, das andere Opern Aubers ähnlich ereilt hat, etwa „Gustave ou le bal masqué“ (1833) gegen Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“ (1859) oder „Manon Lescaut“ (1856) gegen Jules Massenets „Manon“ (1884).
Der Floh von Isoldes Zaubertrank
Die moderne (konzertante) Erstaufführung von „Le Philtre“ beim Festival „Rossini in Wildbad“ lässt es endlich zu, beide Vertonungen miteinander zu vergleichen, was nicht unbedingt zum Nachteil für Auber ausgeht. Während Donizetti den Charakter Nemorinos nicht zuletzt durch die auf seinen Wunsch eingeschobene Arie von der heimlichen Träne gefühlvoll ausgestaltet, bleibt der junge Guillaume bei Auber ein naiver Landbursche, der durch seine Ahnungslosigkeit belustigt, doch in seiner unverstellten Gutgläubigkeit auch berührt.
Dessen Angebetete heißt bei Auber Térézine und ist Donizettis Adina nicht nur an musikalischer Koketterie, sondern auch an durchtriebener Lust an der kalkulierten Quälerei überlegen. Ihre ironische Ballade über die „Reine Yseult“, mit der sie dem armen Guillaume den Floh von Isoldes Zaubertrank ins Ohr setzt, hat schon die typische melodische Brillanz, in die Auber seine Airs und Couplets kleidet. Und die folgende Arie „La coquetterie fait mon seul bonheur“ ist ein Selbstbekenntnis, das denkbar fern jedes tristanesken Liebesrausches liegt: Térézine genießt es, bewundert und angebetet zu werden, aber selbst zu lieben kommt für sie nicht in Frage – jamais! Finden wir hier nicht die kapriziös-seelenlose Pariserin, wie sie der männliche Blick in den schlüpfrigen Jahren von Aubers Erfolgen konstruiert hat?
Der Wein vom Hang des Vesuvs
Die anderen Mitspieler bei Donizetti gleichen Aubers Vorlagen bis hinein in wörtliche Übernahmen im Text: Fontanarose ist der gerissene Händler des „Filtrats“, das er selbst als „Lacryma Christi“ – ein am Vesuv wachsender Wein – entlarvt; seine Arie ist auch bei Auber ein unterhaltsames Zugstück. Und Joli-Cœur, der fesche Sergeant, hat sogar seinen Namen im Italienischen behalten: Belcore. In „Le Philtre“ hat er mit „Je suis Sergent brave et galant“ ein Auftrittslied, dessen einfache Melodik ausgiebig wiederholt und damit zum Ohrwurm gekürt wird.
Dass Auber den militärischen Draufgänger damit auch als einfaches Gemüt charakterisiert, ist Teil seiner Raffinesse. Die zeigt sich stets, wenn Auber seine einfachen, vorhersehbar gestrickten musikalischen Mittel einsetzt, um zu illustrieren und zu charakterisieren. Immer auf leichte Fasslichkeit und gute Unterhaltung bedacht, mutet Auber seinem Publikum weder komplexe Harmonien noch ungewohnte Klangideen zu – sicherlich ein Grund, warum seine Opern trotz ihrer geschickt gemachten Libretti noch vergeblich ihrer Auferstehung harren. In der Anlage seiner Ensembles und Finali entpuppt sich jedoch der Schöpfer der „Muette de Portici“, mit der Auber der „grand opéra“ einen entscheidenden Entwicklungsschub gegeben hat.
Bleibt der Anbeter komplexer Fugen und ausgefeilten Kontrapunkts also unbedient, wird der Liebhaber frisch instrumentierter Melodik und raffinierter Rhythmen umso zufriedener gestellt. In den lichten Bläserakkorden, die den Streichersatz stützen oder färben, finden wir die leuchtende Transparenz seines Zeitgenossen Adolphe Adam wieder. Im mitreißenden Sog des Duetts von Térézine und Guillaume schäumt nicht nur die Wirkung des soeben genossenen Liebestranks auf, sondern auch der Einfluss Gioachino Rossinis. Und die Arie „Philtre divin“ ist ein Paradestück musikalischer Komik, wenn sie die allmähliche Wirkung des zaubrischen Tranks auf den schüchtern-verzweifelten Guillaume schildert, nachdem das vermeintliche Elixier Isoldes in chromatischem Fall die Kehle hinunter geronnen ist.
Der mühelose Klang der Höhe
Diese Szene gestaltet Patrick Kabongo so einfühlsam wie gesanglich tadellos. Der Tenor ist seit gut zehn Jahren im französischen Fach unterwegs und hat seit 2017 immer wieder in Bad Wildbad begeistert. Seine Stimme ist ideal für das Genre der opéra comique: ohne jede Schwere im Ansatz, mit leichtem, dennoch substanzreichem Ton, mühelos beweglich, in der Höhe ohne jeden Druck und ohne Verfärbung, dazu mit einwandfreier Artikulation. Ein vollkommener Genuss, wie er selten zu erleben ist. Luiza Fatyol als Térézine bringt ebenfalls Beweglichkeit und eine kühle Brillanz des Timbres mit und weiß mit Sprache umzugehen. In der Höhe ist ihre Tonemission oft zu impulsiv und wird daher scharf. Die Sängerin gehört zum Ensemble der Deutschen Oper am Rhein und ist in der kommenden Saison u.a. in Mozarts „Zauberflöte“ und „La Clemenza di Tito“ sowie in Verdis „La Traviata“ zu hören.
Als Joli-Cœur setzt Emmanuel Franco eher auf die voluminösen Klänge seines gewaltigen Organs als auf stilistisch reflektiertes Singen. Eugenio di Lieto bringt in seinen Auftritt als „grand docteur“ die Komik ein, die offenbart, wo Jacques Offenbach sein Vorbild gefunden hat. Adina Vilichi ist die Wäscherin Jeanette, die aus ihrer bedeutsamen Nebenrolle in ihrem Couplet zu Beginn des zweiten Akts und in den Ensembles notable Funken schlägt, sich nur vor zu viel Vibrato hüten muss. Wie hoch der Grad an Subtilität war, mit dem Luciano Acocella das Philharmonische Orchester Krakau einstudiert hat, war leider nur zu erahnen: Die Vorstellung musste wetterbedingt im Kurtheater stattfinden und das Orchester hatte im Bühnenraum keine Chance, über einen pauschalen Klang hinwegzukommen. Die träumerische Bläser-Einleitung zu Guillaumes Arie im ersten Akt immerhin hinterließ den Eindruck, Aubers leichtfüßige Brillanz sei durchaus zu ihrem Recht gekommen.