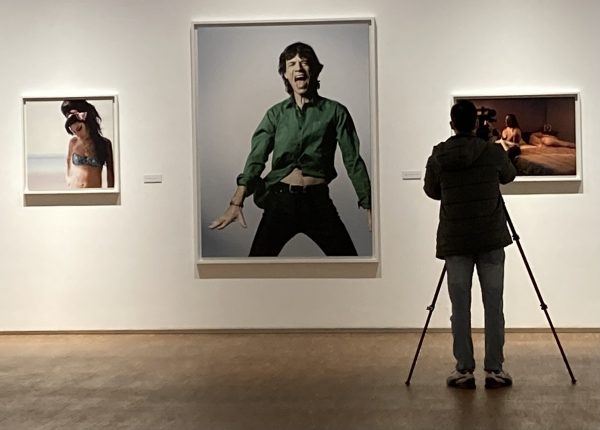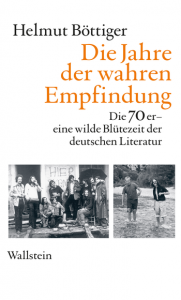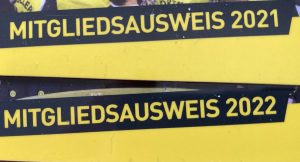Mehr als Charme und Jugend: Lucas und Arthur Jussen zeigen in Essen unterschiedliche Zugänge zu Mozart

Arthur und Lucas Jussen. (Foto: Marco Borggreve)
Zwei Menschen, ein Herz und eine Seele, setzen sich an einen oder zwei Flügel und spielen, als seien sie eins. Wie durch eine geheimnisvolle Aura verbunden, gelingt ihnen vollkommene Synchronie. Alles klingt wie von einem einzigen Geist gelenkt.
In der Tat sind solche Klavier-Duos ein Phänomen, das schon zu Zeiten faszinierte, als Nannerl und Wolferl Mozart zusammen hohe und höchste Herrschaften entzückt haben.
Auch heute ist ein gewisser Sympathiebonus schon vorab gewährt, wenn zwei so smarte junge Pianisten wie Lucas und Arthur Jussen das Podium entern und sich voll sprühender Lebensfreude auf die weißen und schwarzen Tasten stürzen. Die Duo-Abende der beiden Niederländer sind Publikumsmagneten; schon als Teenies hatten sie einen prestigeträchtigen Plattenvertrag. Doch alles auf Jugend und Charme zurückzuführen, wäre höchst ungerecht: Die beiden Brüder sind ernsthafte Künstlerpersönlichkeiten, auch wenn sie in der Zugabe im Siebten Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker ihrem Temperament freien Lauf ließen und Mozart in eigener Bearbeitung irgendwo zwischen Gershwin und Prokofjew landen ließen.
Mozart hätte vermutlich seinen Spaß dabei gehabt und noch eins draufgesetzt. Aber er hätte wohl auch aufmerksam verfolgt, wie es seinen drei Klavierkonzerten zuvor ergangen wäre. Dass Lucas und Arthur Jussen im Konzert für zwei Klaviere und Orchester (KV 365) als ein Herz und eine Seele brillieren würden, war vorherzusehen. Die beiden geben sich bruchlos gegenseitig die Einsätze in die Hände, der eine nimmt sich für den anderen zurück, jeder hört auf den Ton des anderen: ein geistvolles, auch verspielt-übermütiges Hin und Her, geprägt von Eleganz und Noblesse.

Der Essener GMD Tomas Netopil. (Foto: Hamza Saad)
Das Besondere dieses Abends mit dem mozartverständigen GMD Tomáš Netopil am Pult der Essener Philharmoniker war, dass sich Lucas und Arthur als Solisten in je einem Mozart-Konzert vorstellen konnten. Bei den Duos wird ja gerne vergessen, dass sie nicht unbedingt eine Symbiose voraussetzen, sondern sich eigenständige Personen zusammenfinden, die ihr Format auch als Individuen behaupten.
Ein Duo aus zwei Individuen
Und so zeigt sich, dass jeder der beiden Pianisten einen durchaus eigenen Zugang zu Mozart findet: Lucas Jussen hatte sich mit dem d-Moll-Konzert KV 466 das bekanntere und ein für seine verschatteten Stimmungen und seine romantische Expressivität berühmtes Konzert vorgenommen; Arthur, der jüngere von beiden, wählte das A-Dur-Konzert KV 414, das gerne als „heiter“ wahrgenommen wird, mit dem sich Mozart aber den Weg ins „Klavierland“ Wien und unter die Kenner der Musikmetropole bahnen wollte.
Weder Tomáš Netopil noch Lucas Jussen wollen wahrnehmen, was das 19. Jahrhundert am d-Moll-Konzert fasziniert hat: Die Nähe zur „Prager“ Sinfonie KV 504 und zum „Don Giovanni“, das Einlassen auf den „Schwermut“-Charakter der Tonart rücken sie beiseite. Netopil lässt in der Orchestereinleitung zwar die Kontraste hervortreten, wählt aber weiche Phrasierungen und einen mild versonnenen Ton, der mit dem düsteren Dräuen aus der Oper kaum etwas zu tun hat.
Lucas Jussen tastet sich in einer lichten Neutralität durch das thematische Material, das er sich erst allmählich aneignen darf, um dann in gelassener Nonchalance durch die Figurationen zu treiben, bis er sich in der Kadenz konzentriert und gestaltungsmächtig erweist. Auch der zweite Satz, die „Romance“ wird von Netopil eher leicht und lyrisch gelesen, während der Pianist die Färbungen zurückhält, um ja keinen Anflug eines „romantischen“ Tons zuzulassen. Das Orchester mit einer dominanten Flöte plustert sich gegen das Klavier zu vordringend auf: Die Balance will sich nicht recht einstellen. Allerdings gibt Netopil den Bläsern Raum, sich in ihrer Rolle zu präsentieren und das Miteinander mit Jussens brillanter „Execution“ des finalen Allegro assai auszukosten. Was bleibt, ist der Eindruck einer funkelnden, aber emotional distanzierten Ausleuchtung des Konzerts. Es klingt mehr nach kühlem französischem Rokoko als nach den jenseitigen Ahnungen E.T.A. Hoffmanns.
Beredte Gesten, vollendete Poesie
Anders Arthur Jussen im A-Dur Konzert: Er findet im ersten Satz durchaus die unbeschwerte Finesse, das „Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht“. Er lässt das figurative Spiel – wie Mozart sagt – „angenehm in die ohren“ klingen. Aber er kennt auch die beredte Geste, den rhetorischen Charakter von Mozarts Musik, die man mit der Oper im Hinterkopf zu identifizieren weiß. Im Andante phrasiert er selbstvergessen fließend, lässt die Melodik poetisch schwingen, findet zu einer introvertierten Innenspannung, die den berückenden Schimmer der Melodik betont.
Mit dem raffiniert simplen Rondeau-Thema reißt Mozart diesen zaubrischen Schleier auseinander – und Arthur Jussen bringt die Spieluhr zum Klingeln und lässt sich leicht und hell auf die gar nicht einfache Bearbeitung der thematischen Vorgabe ein. Die Essener Philharmoniker können sich nach der Pause in zwei Sätzen aus der Ballettmusik zu „Idomeneo“ zeigen: Der harte Schlag der Pauke und die temperamentvollen Streicher sorgen für einen energischen Zugriff, den Netopil später dämpft. Aber er verdeckt in seiner eher eleganten als expressiven Lesart nicht, mit welch unendlicher Erfindungsgabe Mozart selbst dieses Genre adelt.
Die nächsten Auftritte von Lucas und Arthur Jussen in der näheren Umgebung sind am Freitag, 22. April, in Arnhem (NL) und am Sonntag, 3. Juli, beim Klavier-Festival Ruhr im Anneliese Brost Musikforum Bochum.