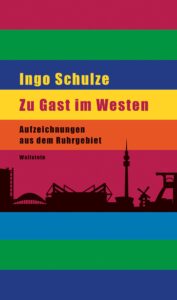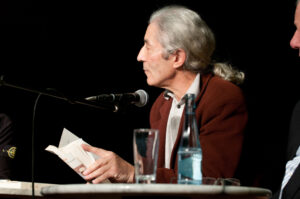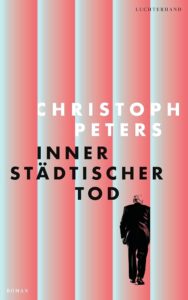An diesem imposanten Ort beginnen die Ruhrgebiets-Erkundungen von Ingo Schulze: die kruppsche Villa Hügel in Essen. (Foto von Januar 2006: Bernd Berke)
Ein halbes Jahr lang war Ingo Schulze so etwas wie der Stadtschreiber des Ruhrgebiets, Oktober 2022 bis März 2023, Wohnsitz in Mülheim, eingeladen von der Brost-Stiftung. Zwei Dinge hatte er sich für diese Zeit vorgenommen, nämlich erstens an streng durchstrukturierten Arbeitstagen halbtags an seinem neuen Roman zu arbeiten und zweitens jede Einladung anzunehmen, die er in seiner Ruhrgebietszeit erhielt. „Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf mich selbst reinfalle“, schreibt er in der Rückschau, „keine Zeile habe ich an meinem Roman geschrieben.“
Das Ruhrgebiet, so könnte man folgern, erregte des Dichters ganze Aufmerksamkeit. Aber interessante Menschen hat er getroffen, Lehrerinnen, Polizisten, Gewerkschafter, Techniker, Buchhändler und so fort, eine bunte Mischung. „Zu Gast im Westen – Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet“ heißt das Buch, das Schulzes Begegnungen und Recherchen nun in recht entspannter Form versammelt – keine Skandalliteratur, ganz sicher nicht, auch keine geographische Liebesprosa.
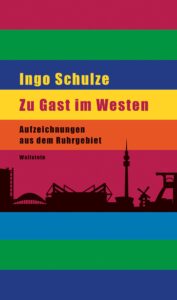
Das Thema wirkt zunächst einmal wie falsch gestellt. Denn gängig sind ja nach wie vor eher die Berichte über den Osten, besonders über die Unzufriedenheit der dortigen Abgehängten und Rechtsradikalen. Hier aber nun: sachliche Berichte aus dem Westen, von Ingo Schulze mit Ernst und Akribie aus kaum wahrnehmbarer „Ost-Optik“ heraus verfaßt.
Die Jahre nach der Wende
Mit seinem opulenten Nach-Wende-Roman „Neue Leben“, schrieb Schulze sich in bleibende, respektvolle Erinnerung. Das knapp 800 Seiten starke Buch, 2005 erschienen, gab einem eingefleischten Westler (wie dem Verfasser dieser Zeilen) etwas mehr als eine Ahnung davon, was der Untergang der DDR mit Menschen in verschiedenen Milieus machte. Es war eine Zeit, wie sie unterschiedlicher in Ost und West ja kaum sein konnte; was „drüben“ Existenzen von Grund auf umkrempelte, reduzierte sich im Westen auf Tagesschaunachrichten. Später hat Schulze auch in, wenn man so will, ostdeutschen „Langzeit-Befindlichkeiten“ gegründelt, hat etwa in „Die rechtschaffenen Mörder“ (2020) den langsamen, unerbittlichen und offenbar ungeheuer kränkenden Bedeutungsverlust eines einstmals schillernden, luziden Buchhändlers und seiner Bücher beschrieben. Ganz leicht war das Verletzende in dieser Geschichte für den Westler nicht zu greifen, doch blieb der Eindruck großer Redlichkeit, der Ingo Schulzes Texten Mal um Mal eigen zu sein scheint.
Bei Krupp in Essen
So. Und nun tut sich der Dichter, 1962 in Dresden geboren und wohnhaft in Berlin, im Ruhrgebiet um, und er fängt dort an, wo es vielleicht immer noch seinen Markenkern hat, bei Krupp in Essen, Villa Hügel. Schulze, dessen Weltbild einst vermutlich vom Hauptwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital geprägt wurde, entwickelt großes Interesse am real existierenden Kapitalismus im Westen der Republik; er arbeitet anerkennend heraus, wie die Montan-Mitbestimmung über Jahrzehnte hin funktioniert hat, stellt aber auch fest, daß sie Betriebsschließungen – wie die von Rheinhausen – nicht verhindern konnte. Schulze recherchiert recht journalistisch, doch mitunter kommt am Ende eher Literatur dabei heraus. So, wenn er ähnlich Bert Brechts lesendem Arbeiter fragt, was aus dem flammenden Streikredner nach seiner letzten Rede wurde. (Er machte sich im Recycling selbständig, ging später bankrott.)
Irritierender Namensgeber
Schulze irritiert, daß Alfried Krupp von Bohlen und Halbach immer noch Namensgeber von Essener Einrichtungen wie der Philharmonie ist, obwohl er nach dem Krieg als Kriegsverbrecher eingestuft und interniert wurde. Ebenso aber registriert er auch, daß Berthold Beitz, der legendäre Krupp-Generalbevollmächtigte, in der Nazi-Zeit viele jüdische Mitarbeiter vor der Deportation bewahrte, indem er sie als betrieblich unabkömmlich meldete. Beitz’ Liste war jener Schindlers ähnlich.
Schulzes Krupp-Geschichte hat, wie einige andere Beiträge im Buch auch, in etwa den Umfang und Rechercheaufwand einer profunden schulischen Hausarbeit. Schlußendliche Wertungen bleiben aus, eher fällt dem Autor auf, daß die Menschen einander doch recht ähnlich sind, im Osten und im Westen.
Emscher-Renaturierung in allen Details
Den Duisburger Hafen besichtigt er, er schreibt über schulische Konzepte in schwierigen, durch Migration geprägten Stadtteilen, läßt sich von einem pensionierten Polizeichef spezifische Probleme mit arabischer Clan-Kriminalität erklären, ist schwer beeindruckt von der Emscher-Renaturierung. Bei letzterer hat er aus Schriften der Emschergenossenschaft abgeschrieben (bzw. ausführlich zitiert), und das teilt er auch ausdrücklich mit. Da geht es um die komplexe Technik, die die Reinigung der Emscher möglich macht, und wer so viel Technisches nicht wissen will, mag diesen Abschnitt getrost überblättern. Der Dichter selbst rät dazu.
Leider tut er gleiches nicht, wenn es um unorthodoxe Grundschulpädagogik geht, die weitgehend ohne deutsche Sprache auskommen muß. Da wird der Text ausladend und detailverliebt. Seitenlang beschreibt er fast wie ein Manual das Procedere, ohne nach dem theoretischen Konzept zu fragen, das dem Ganzen doch sicherlich zugrundeliegt. Hier wäre Raffung ein Gewinn – oder à la Kläranlage der technische Hinweis an pädagogisch Desinteressierte, wieviele Seiten man überblättern kann.
Ein Fan von Borussia Dortmund
Der Schriftsteller sitzt im Orchestergraben und besichtigt einen Soldatenfriedhof; die naturgemäß abenteuerliche Geschichte eines DDR-Flüchtlings, der damals über Ungarn ins Revier kam, gelangt zum Vortrag, und dann ist da natürlich der Fußball. Schulze offenbart sich als Fan von Borussia Dortmund, und deshalb gibt es auch die entsprechenden Spielberichte. Die aber sind so anders nicht als jene, die man schon kennt, gelbe Wand und so weiter. Wiederum bleibt festzustellen, daß das tägliche Leben im tiefen Westen so anders nicht zu sein scheint als im Osten der Republik.
Die Liebe zu den Büchern
Ein nostalgischer Schlußakkord schließlich ist dann der Besuch in Helmut Loevens Duisburger „Weltbühne“, einer der letzten dezidiert linken Buchhandlungen. Kommunistische Literatur aus aller Welt, gut behütet und geordnet, unendlich wertvoll und kaum noch nachgefragt. Loeven und Schulze – mehrfach begegnen sich hier zwei Buch-Afficionados, und wenn sie sich ihre Vorlieben eingestehen, ist das fast schon ein intimer Moment, bei dem der Leser stört.
Der junge Dortmunder Bundestagsabgeordnete
Merkwürdig geriet, für Dortmunder zumal, der allerletzte Teil des Buches. Da besucht Ingo Schulze den langjährigen Dortmunder Ex-Bundestagsabgeordneten Marco Bülow und läßt sich von dem – widerstandslos, könnte man fast sagen – in den Block diktieren, wie das alles begann und sich eher unglücklich fortsetzte. Ohne in Details gehen zu wollen sei angemerkt, daß die Geschichte des SPD-Abgeordneten Bülow, der die letzten drei Jahre als Parteiloser (bzw. als Neumitglied von DIE PARTEI) in vielen Punkten auch anders erzählt werden könnte. So war seine Nominierung zumindest nicht nur Folge persönlicher Beliebtheit, sondern auch Resultat einer neuen Rekrutierungsstrategie der Partei, die unbedingt jünger und weiblicher werden wollte und alte Schlachtrösser wie Bülow-Vorgänger Hans Urbaniak dafür gerne in die Wüste schickte. Möglicherweise hat dieser recht senkrechte Start dem jungen Bülow nicht gutgetan, hat ihn überfordert, und möglicherweise wäre Schulze dieser alles in allem doch recht bizarren Politikerkarriere durch kluge Nachfragen näher gekommen als durch unkritisches Protokollieren. Nur so viel zu diesem Teil des Buches.
Wertvolle Fleißarbeit
Nun gut. Um „Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet“ ging es, und da ist der Dichter in seinen Entscheidungen frei, was er aufzeichnen möchte und was nicht. Natürlich hätte man sich auch Beiträge vorstellen können, etwa zum Straßenverkehr (Schulze ist notorischer ÖPNV-Nutzer oder Mitfahrer) oder zur Kleinkunst, beispielsweise. Trotzdem geriet Schulzes Buch alles in allem zu einer Fleißarbeit, wohltuend in seiner durchgängigen Sachlichkeit – eine wertvolle Ergänzung der Regalabteilung mit den regionalen Schriften.
- Ingo Schulze: „Zu Gast im Westen – Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet“, Wallstein Verlag, 344 Seiten, keine Bilder, 24 €.