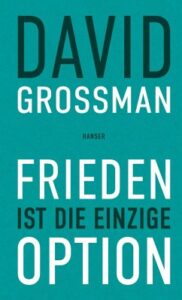In der Gummizelle: Kathrin Zukowski (Ilia), Kinderstatist, Anna Lucia Richter (Idamante), Peter Bermes (Idomeneo). (Foto: Sandra Then)
Der alte Mann entkommt seiner Zelle nicht. Auf weiße gepolsterte Wände zeichnet er mit nervösem Strich immer wieder das gleiche Männchen, mit einem Dreizack in der Hand. Beim Familienbesuch rastet er aus, muss mit einer Spritze ruhiggestellt werden.
Floris Visser führt während der Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozarts „Idomeneo“ die Titelfigur als einen Gezeichneten ein. Kein herkömmliches Regietheater-Irrenhaus-Setting: Denn die Zelle weitet sich, eröffnet einen Hintergrund in hyperrealistischem Licht, mit dem James Farncombe die felsige Strandlandschaft der Bühne Jan Philipp Schlößmanns in überzeichnet scharfe Konturen taucht. Der Naturalismus eines „Schauplatzes“ wird so ausgehebelt; der alte Mann, unschwer als Idomeneo zu identifizieren, beginnt durch seine innere Landschaft zu irren.
Mit seiner Inszenierung an der Oper Köln im Staatenhaus versucht Visser, diese Seelenwelt eines Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung einzuholen – einer psychischen Verwundung, die in Flashbacks Erlebnisse der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit so intensiv zurückholen kann, dass die betroffene Person die Erfahrung wieder und wieder mit der gleichen emotionalen Intensität durchleidet und sogar unfähig sein kann, sie als Erinnerung zu identifizieren. So flutet Visser die Bühne mit heterogenen Bildern und Szenen, in denen Idomeneo doppelt präsent ist – als Uniform tragender Soldat Bestandteil des Geschehens; als Greis im Nachthemd ein stummer, staunender oder leidender Beobachter. Er steht im wahrsten Sinn des Wortes „neben sich“, wenn er sogar einmal den gemarterten Feldherrn Idomeneo in den Arm nimmt.
Unablässiger Aktivismus
Drei Stunden dichte, in kaum einem Moment ihre Tiefe und Komplexität verlassende Musik hat Visser szenisch zu bewältigen. Er setzt den langen Rezitativen einen unablässigen Aktivismus entgegen. Auch die Arien erlauben keine Ruhepunkte. Im Sinne des Konzepts ist das folgerichtig, denn ein Flashback kennt kein Innehalten und Reflektieren. Aber der Zuschauer, der nach dem Zeichenhaften der Aktionen sucht, wird von der Dynamik der szenischen Unermüdlichkeit zugeschüttet. Irgendwann stumpfen die visuellen Ausrufezeichen ab. Aber – das muss Visser zugestanden werden: Die penetrante Qual, die im Wiederholen traumatisierender Momente liegt, spiegelt sich in dieser Tretmühle der Zeichen wider.

Der Fluch der Gewalt gebiert das Trauma: Daniel Calladine personifiziert es in Floris Vissers „Idomeneo“-Inszenierung in Köln. (Foto: Sandra Then)
Visser verwendet Bilder aus den Kriegen der Gegenwart: Leichensäcke am Strand, Menschen, die Tote identifizieren müssen, das ertrunken angespülte geflüchtete Kind Alan Kurdi, die Anzüge von Abu Ghraib in Orange, Opfer mit verhüllten Köpfen, eine Trauerfeier an sandigem Gestade. Er verbindet diese Kriegs- und Gewaltchiffren mit Hinweisen auf den antiken Mythos: Eine schwarze Gestalt, „das Trauma“ (Daniel Calladine) geistert mit einem Beil durch die Szenerie, das auf den Tod Agamemnons und den Fluch der Atriden hindeutet. Anderes wirkt überzogen, etwa eine Szene, in der Idomeneo offenbar in den trojanischen Krieg abberufen wird, als er gerade mit seinem Kind Idamante am Strand ein Badetuch ausgebreitet hat. Deplatziert auch die griechische Fahne, neben der am Ende einträchtig eine türkische flattert. Solche allzu expliziten Verweise stören den psychologischen Gedankengang durch weit hergeholte politische Konkretion.
Zweifel am Sieg der Liebe
Wenn im Finale „die Stimme“ (Lucas Singer) – und, wohlgemerkt, nicht Neptun oder ein anderer der Götter – die Lösung verkündet, spricht der alte Idomeneo (Peter Bermes) tonlos auf der Bühne mit. Ein Funke Hoffnung? Ob aber wirklich die Liebe über alles siegt, zweifelt Vissers Schlussbild leise an: Sinnierend liest Ilia, die trojanischen Prinzessin, die eigentlich die „natürliche“ Feindin der Griechen sein müsste, ein Holzpferd ihres Kindes auf – ein Verweis auf das trojanische Pferd und die eigene, nach Vergeltung rufende Wunde?
Auch im Orchestergraben gelingt es nicht durchgehend, die Spannung zu halten. Bei aller Wertschätzung dieses genialen Wurfs eines 25-Jährigen neigt man dazu, die eine oder andere Kürzung in den Rezitativen als sinnvoll zu erachten. Rubén Dubrovsky verführt das Gürzenich Orchester schon in der Ouvertüre zu feinsinnig detailreichem Spiel. Er fasst den Klang mit scharfer Kontur, lässt luftige Bläserakzente setzen, hebt generell hervor, mit wie unermüdlicher Kreativität Mozart die Fallen gleichförmiger Wiederholungen, stereotyper Harmonie oder schematischer Instrumentation umgeht. Anderes, so das berühmte Quartett des dritten Akts, bleibt seltsam blass. Aber das Gürzenich Orchester spielt in der ganzen langen Zeit hoch konzentriert und verströmt elegant ausgewogenen Mozartklang.
Insgesamt eine gediegene Besetzung
Intendant Hein Mulders hat für diesen ambitionierten „Idomeneo“ eine insgesamt gediegene Besetzung verpflichten können: Sebastian Kohlhepp ist ein anfangs etwas kehlig intonierender, sich zunehmend frei singender Idomeneo, der in den Koloraturen seiner Arie „Fuor del mar“ alle inneren Qualen freilegt, da er die Bedrohung durch Neptun im fürchterlichen Meer seines Herzens weiter spürt.
Kohlhepp ist in den dramatischen Momenten ebenso sicher wie in dieser expressiven Beweglichkeit, die weniger auf technischen Glanz als auf den existenziell aufgewühlten Ausdruck achtet. Auch als Darsteller steigert er sich mit beinah stummfilmhafter Intensität in die Rolle eines Menschen, dessen furchtbarstes Schicksal ist, sich selbst nicht entkommen zu können. Floris Vissers Vorzeigetheater lässt ihn dabei keinen Moment allein. In der Arie „Vedrommi intorno“ erweitert er den Schauder vor dem bald zu vergießenden Blut: Eine nackter blutiger Junge erinnert Idomeneo wohl auch an die Opfer, die der Krieg um Troja gekostet hat. Die Orchesterbegleitung dieser Arie gehört übrigens zu den Höhepunkten des Abends.
Aus der Stimme gestaltete Musik

Anna Lucia Richter als Idamante. (Foto: Sandra Then)
Eine nahezu ideale Besetzung ist Anna Lucia Richter in der Rolle des Idamante: eine sanft geführter, ausgeglichener, leuchtender Mezzo, der den edlen, empfindsamen Charakter des jungen Prinzen in purem Wohllaut repräsentiert, ohne die entspannte Tonbildung aufgesetzten expressiven Gesten zu opfern. Gestaltung aus der Musik und aus dem Material der Stimme: Hier wird’s zur beglückenden Realität.
Auch Kathrin Zukowski punktet als Ilia mit kultiviertem Singen und einem zarten, gepflegten Timbre. Sie neigt allerdings zu flachen, manchmal dünn-ungestützten Tönen, die sie nicht nötig hat, um die lyrische Grundierung etwa von „Zeffiretti lusinghieri“ – einem vokalen Paradestück der Oper – zu sichern. Mit einer abgesicherten Stütze im Körper könnte Zukowski auch die ausdrucksvolle Deklamation in den Rezitativen technisch perfektionieren.
Ana Maria Labin stellt sich mutig und erfolgreich der Herausforderung, die „Furien der grausamen Unterwelt“ – bei Visser treten sie natürlich leibhaftig auf – in schneidender Dramatik zu beschwören und die bizarren Ausbrüche ihres wütenden Abgangs am Ende zu erfassen. Aber in ihrer Liebesarie im zweiten Akt zeigt sie auch ihre andere Seite, die einer zärtlich fühlenden Frau, die sich trügerischen Hoffnungen hingibt und daher umso herber enttäuscht wird. Anicio Zorzi Giustiniani darf sich als Arbace mit ausgeprägtem, manchmal zu grell nach vorne gedrängtem Ton ebenfalls in zwei Arien zeigen; John Heuzenroeder ist ein würdig gefasster Oberpriester.
Der Chor der Oper Köln (Rustam Samedov) ist eines großen Kompliments würdig für die wie selbstverständlich wirkende Integration in die szenische wie musikalische Seite der Aufführung. Floris Vissers Bildertheater ist durchaus eine Zumutung; wer sie als bloß illustrativ wahrnimmt, wird des Abends irgendwann einmal überdrüssig. Wer sie als Spiegel einer seelischen Zerstörung akzeptiert, wird in ihrer Penetranz die unheilvollen psychischen Abläufe erkennen, die – über den Kriegsheimkehrer Idomeneo hinaus – heute Tausende von Menschen innerlich überfluten.
Weitere Vorstellungen: 25., 28. Februar, 2., 8., 10., 13. März. Info: https://www.oper.koeln/de/programm/idomeneo/6687