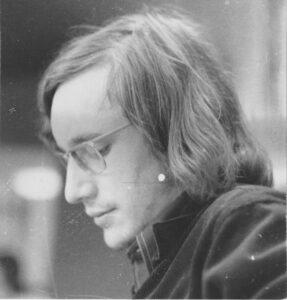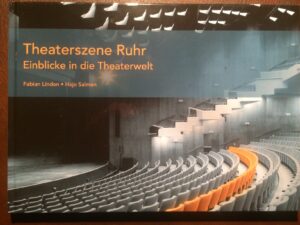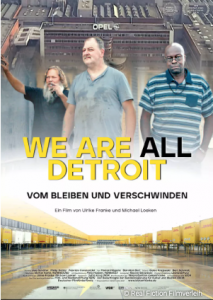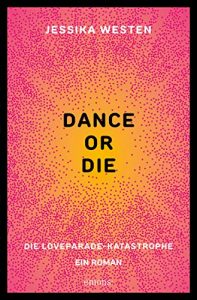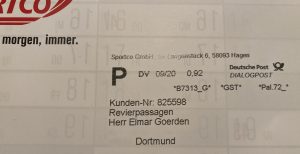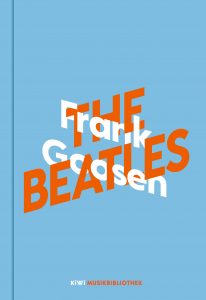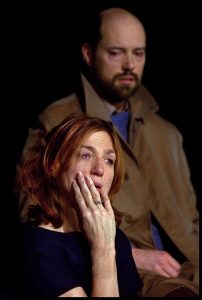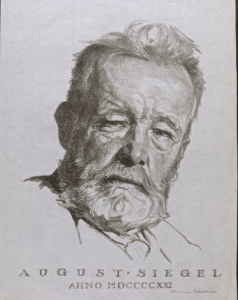Als man sich noch für „richtig links“ halten wollte
Kinners, heute erzählt Euch der Boomer-Opa ein klitzekleines bisschen von früher. Keine Angst, es werden nur ein paar Schlaglichter sein. Und nur die fernen Echos wahrer Klassenkämpfe. Wie denn damals im Revier überhaupt nur der Widerhall aus den wirklichen Metropolen zu vernehmen war.
Als ich studiert habe, hatte man gefälligst „links“ zu sein, was immer das wirklich heißen mochte. Wir waren uns jedenfalls fraglos sicher – und es schien ja in dieser Hinsicht auch noch wesentlich übersichtlicher zu sein als heute. Freilich sinnierte schon damals Botho Strauß in Gestalt seiner Lotte im Stück „Groß und klein“: „In den 70er Jahren finde sich einer zurecht…“
Bevorzugte „Quelle“ bzw. Hilfsmittel für jegliche Interpretation waren jedenfalls damals bei den Bochumer Historikern die blauen Bände der Marx-Engels-Ausgabe. Es herrschte unter den Studierenden (die damals noch Studenten geheißen wurden) weithin die Auffassung, alle geschichtlichen Geschehnisse jedweder Epoche müssten damit abgeglichen werden. Umso pikierter war ich, als ich eines Tages einen Brief von Karl Marx an seine Geliebte zu lesen bekam, der mit dieser Anrede begann: „Viellieb!“ Das wollte mir süßlich-kitschig vorkommen und sich so gar nicht zu seinen politischen Einsichten fügen. Ach, Gottchen!
Ein unerbittlicher „Anarchist“
In jenen seltsamen Zeiten gerierte sich ein Altersgenosse vehement als „Anarchist“. In einer stundenlangen hitzigen Wohnzimmer-Debatte ließ er sich nicht erweichen. Er hätte am liebsten alles in die Luft gesprengt, wie er posaunte. Wir anderen waren hingegen der Ansicht, dass er damit erst recht die volle Staatsgewalt gegen uns alle entfessele. Schließlich suchte ich den Kompromisslosen zu besänftigen, indem ich ihn zum Abschied herzhaft mit „Rot Front!“ grüßte. Er aber dröhnte, vollends unversöhnlich: „Schwarz Front!“ Wüsste gerne, was später aus ihm geworden ist. Vielleicht denn doch noch eine Gestalt auf der allseits abgesicherten Beamtenlaufbahn? Ist aber auch piepegal. Kaum jemand, der sich nicht angepasst hätte.
Den Hass auf die Bourgeoisie fühlen
Unwesentlich später war man schon auf die damals so genannte „Neue Sensibilität“ verfallen, die längst nicht mehr so harsch politisierte, sondern in Sanftmut und Milde daherkam, gleichsam auf Samtpfoten. Dennoch ließ ich mich bei irgend einer obskuren Splittergruppe für ein ganzes Wochenende auf eine „trotzkistische Schulung“ ein. Es blieb beim einmaligen Besuch, wie ich denn überhaupt nie dauerhaft Partei ergreifen mochte. Wer zweimal bei denselben sitzt, bekommt schnell den Verstand stibitzt. Gut, wa? Von mir. Ganz spontan.
Dem unerträglichen Trotzkisten-Präzeptor, der keinen Widerspruch duldete, sondern nur von oben herab dozierte, wagte ich die Frage zu stellen, ob denn bei ihnen alles nur rational vonstatten gehe oder ob man irgendwann auch Gefühle zeigen dürfe. Er, vollends am Sinn der Frage vorbei: „Ja klar, den Hass auf die Bourgeoisie!“ Aha. Zur Erholung vom stundenlangen Gefasel durften wir dann nachmittags Fußball spielen. Immerhin. Man war nicht nur ein Tor, man schoss auch eins. Harr, harr.
Durften die Beatles Mao schmähen?
Man war, so cirka zwischen 16 und 24 Jahren, dermaßen verblendet, dass man die Mao-Bibel reichlich unkritisch memoriert hat. Sogar den vor- und nachmals so verehrten Beatles nahm man die Zeilen aus dem Song „Revolution“ übel: „But if you go carrying pictures of chairman Mao, you ain’t gonna make it with anyone anyhow…“ Wie? Was? Nö, die Stones waren auch nicht viel mutiger, siehe ihren resignativen Text über den „Street Fighting Man“: „But what can a poor boy do except to sing for a Rock’nRoll Band, cause in sleepy London town there’s just no place for a street fighting man, no!…“
Jetzt mal gar nicht zu reden von Bettina Soundso, in die ich mich für einige Monate verguckte, weil sie (die es mit dem MSB Spartacus hielt) mir so heroisch wie eine zweite Rosa Luxemburg vorkam. Hach. Später ward sie wahrhaftig Geschichts-Professorin. Aber wie sie damals ihren Haarvorhang herunterlassen konnte, um dahinter gewichtig zu reflektieren! Überhaupt erwies sich das unentwegte Politisieren gelegentlich als „Liebes“-Beschleuniger, wahrscheinlich aber auf längere Sicht noch öfter als zerstörerisch.
„Deutscher Herbst“: Polizei in der Pizzeria
Zeitsprung: Aus dem „Deutschen Herbst“ um 1977 habe ich unter anderem in Erinnerung, wie die Polizei mit Maschinenpistolen im Anschlag eine Pizzeria enterte, in der wir friedlich beisammen saßen. Wiederum einige Jahre später suchte mich ein Mann vom Verfassungsschutz zu Hause in meiner kurzzeitigen WG auf, um mich nach einem Schulfreund auszufragen, der die Beamtenlaufbahn einschlagen wollte. Aber da waren wir schon in den öden 1980ern gestrandet. Und es gab überhaupt nichts zu beichten.