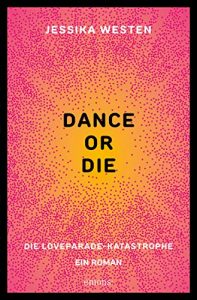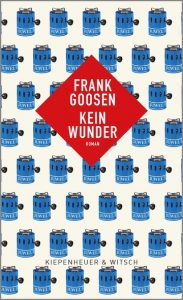Museen geschlossen, Frank Goosen ausverkauft: Ärger und Freude liegen im Kulturbetrieb des Reviers nahe beieinander

Von außen sieht man ihm seine charakteristischen Tütenlampen gar nicht an: das Schauspielhaus Bochum, wo Frank Goosen sein „Silvester Spezial“ zur Aufführung brachte. (Foto: Schauspielhaus Bochum/Martin Steffen)
Frank Goosen, das ist mal klar, Frank Goosen hat uns gerettet. Das „Silvester Spezial“ des Bochumer Kabarettisten, dargebracht im Großen Haus des Bochumer Schauspiels, fügte sich exakt in die Erfordernisse des diesjährigen Besuchsbespaßungsprogramms: Beginn um 20 Uhr und um die zwei Stunden lang, so daß es bis zum Jahreswechsel dann nicht mehr weit war. Die Silvesterparty im Schauspielhaus knickten wir uns und strebten hernach den heimischen Dortmunder Fleischtöpfen zu. Guter Abend, gutes Timing, 2025 konnte kommen.
Ruhrgebietskultur
Warum erzähle ich das eigentlich? Nun, weil die Berliner Verwandtschaft in diesem Jahr bei uns zu Gast war und man dann natürlich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, richtig schöne Ruhrgebietskultur vorzuführen. In vielen Vorjahren war – in Berlin – die Komische Oper ein prominenter verwandtschaftlicher Bespaßungsort, aber die wird ja jetzt umgebaut und Barrie Kosky ist auch nicht mehr da und überhaupt. Also finde mal was, hier im Revier, wenn es nicht traditionelle Operette sein soll. Nun, wir fanden, wie gesagt, ihn, Frank Goosen, den man mit seiner grundsoliden Bochumer Erdung nebst gleichzeitiger, hochgradig anregender intuitiver Beweglichkeit und profundem historischen Spezialwissen auswärtigem Publikum durchaus zumuten kann, ja geradezu: sollte.
Andreas Weißert las in Dortmund
Der Fairneß halber sei ergänzt, daß auch andere Bühnen Jahresausklangsprogramme anboten. So las der geschätzte Schauspieler Andreas Weißert auf der Dortmunder Studiobühne wieder etwas vor, Textpassagen von Fontane, Kästner, Fallada und Bernhard unter dem Titel „Es ist ein hübsches Wort, daß die Kinder ihren Engel haben“ (ein Fontane-Zitat). Nur – um 16 Uhr fing er an und anderthalb Stunden später war er fertig, das ist dann noch verdammt viel Zeit bis Mitternacht.
Volle Hütte
Bei Goosen war das Theater voll, ganz offensichtlich giert das Volk nach Jahresendkultur. Da paßt es – Vorsicht, Ironie! – wunderbar ins Bild, daß die heimischen Museen an den letzten Tagen des Jahres einfach zumachen. Das Dortmunder „U“, zentrale Adresse, blieb zwischen 30. Dezember und 1. Januar, also von Montag bis Mittwoch, drei Tage immerhin, geschlossen, und in etliche anderen Städten hielten kommunale Museen es ebenso. Offensichtlich war hier eine Bürokratie am Werke, die die Welt in Brückentagen denkt und nicht in Publikumsinteresse. Warum sollte man an kalten, nassen Winter-Werktagen „zwischen den Jahren“, die wirklich nicht zu Spaziergängen irgendwelcher Art einladen, Museumsbesuche ermöglichen? Und der Montag ist eh sakrosankt, liege er für das ungeliebte Publikum auch noch so günstig zwischen den Feiertagen. Es macht die Sache übrigens nicht besser, daß wir, wären wir in Berlin gewesen, ebenfalls vor größtenteils geschlossenen Häusern gestanden hätten. Die Ignoranz einer selbstgefälligen kommunalen Bürokratie ist ein bundesweites Phänomen.
Offene Türen beim Schraubenkönig
Private Museen hingegen kennen das Publikumsinteresse und haben ihre Angebote angepaßt. So läßt „Schraubenkönig“ Würth die Tore seiner drei Häuser in und um Künzelsau jeden Tag von 10 bis 18 Uhr öffnen, das Potsdamer Museum Barberini, das SAP-Chef Hasso Plattner gehört, bot am 1. Januar zumindest Führungen durch das Haus an, und ebenso hatte die Duisburger Küppersmühle am 1. Januar geöffnet.
Wenigstens haben wir den Kran gesehen
In Dortmund, wo Tage vor Silvester museal nichts mehr ging, blieb als touristische Aktion schließlich noch eine Stadtrundfahrt mit dem eigenen Auto, Borsigplatz, Westfalenhütte (wo große städtebauliche Veränderungen anstehen), Hoesch-Museum (geschlossen wegen Umbau). Weiter über Malinckrodtstraße und Nordmarkt zum Hafen, wo vis-à-vis vom wilhelminischen Hafenamt der alte Kran zu besichtigen ist, den man weiter unten auf dem Hafengelände abgebaut und hier, auf der Vorzeigemeile, wieder aufgebaut hat. Gut, wenigstens diese Besichtigung hat geklappt, umsonst und draußen, wie es sein soll bei einem Freiluftindustriedenkmal.
Und es ging auch vom Auto aus. Mistwetter, wie gesagt.