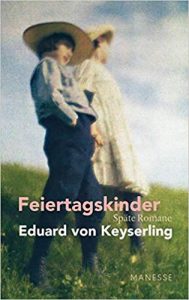Mit bösem Blick die feine Gesellschaft sezieren – aus den Tagebüchern der Brüder Goncourt
Diese Texte sind 1989 schon einmal in Hans Magnus Enzensbergers „Anderer Bibliothek“ erschienen. Na und? Wenn bislang vergriffene Bücher das Entdecken oder (Wieder)-Lesen lohnen, dann solche. Kurz und gut: Der Verlag Galiani hat mit der Neuausgabe der „Blitzlichter“ einen Glücksgriff getan.
Es handelt sich um Auszüge aus den phänomenalen Tagebüchern der Brüder Goncourt, mit denen man so recht ins glanzvolle Paris des 19. Jahrhunderts samt all seinen exzentrischen Dichtern und Künstlern, den Salons und Soiréen, Kurtisanen und Kokotten „eintauchen“ kann.
„…sind mir diese Dirnen gar nicht so unangenehm“
Doch schon der Prolog der von Anita Albus glänzend übertragenen Aufzeichnungen zeigt, dass es nicht ums bewundernde Schwelgen geht – im Gegenteil. Edmond und Jules de Goncourt hatten den bösen Blick, mit dem sie die damalige „feine Gesellschaft“ nach Belieben sezierten und allerlei Sottisen noch über die vermeintlich erlauchtesten Geister zu Papier brachten; ja, das Wort Sottisen könnte geradewegs für solche literarischen Kabinettsstücke erfunden worden sein.
Dass es dabei selbst für heutige Begriffe sehr freizügig zugeht und immer wieder das frivole, oft genug auch bizarre Treiben der offenbar zahllosen Huren und ihrer ach so „edlen“ Klientel geschildert wird, versteht sich beinahe von selbst. Irgendwoher muss das Paris von einst seinen Ruf ja haben… Die Übersetzerin wählte übrigens mit Bedacht den Ausdruck „vögeln“ und nicht das derbe F-Wort. Die Goncourts goutierten finanziell „ausgehaltene“ Frauen: „Alles in allem sind mir diese Dirnen gar nicht so unangenehm. Sie heben sich ab von der Eintönigkeit, der Rechtschaffenheit, der gesellschaftlichen Ordnung (…) Sie bringen ein bißchen Tollheit in die Welt.“
Der Band ist alphabetisch nach beschriebenen Personen geordnet. Das Verzeichnis klingt wahrlich imposant. Die Brüder haben – aus mehr oder weniger regelmäßigem Umgang – Berühmtheiten gekannt wie: Charles Baudelaire, Daudet, Degas, Flaubert, Gautier, Victor Hugo, Huysmans, Maupassant, Rimbaud, Rodin, George Sand, Turgenjew, Verlaine und Zola – um nur eine erlesene Auswahl zu nennen.
Monsieur Flaubert und sein „Büffel-Frohsinn“
Selbst vor einem literarischen Genie wie Gustave Flaubert knieten sie keineswegs nieder. Gewiss haben sie spürbar gern mit dem Arbeits-Berserker geplaudert, doch bezeichnen sie den Monsieur aus dem normannischen Rouen als Grobian und provinziellen Effekthascher. Zitat: „Er ist ein maßloser Tolpatsch, schwerfällig in allen Dingen, im Scherz, in der Übertreibung (…) Seinem Büffel-Frohsinn geht jeglicher Charme ab.“
Mit Kaiser Napoleon III. und der wohl recht schwatzhaften Kaiserin Eugénie haben die Brüder Goncourt gleichfalls gesellschaftlich verkehrt. Auch über sie belustigen sie sich, so dass man durchaus nachvollziehen kann, dass die Aufzeichnungen erst im Jahr 1956 unzensiert erscheinen konnten. Der Kaiser, so erfahren wir, habe sich aus den Opernkulissen gern willige junge Frauen kommen lassen, die er in seiner blickdicht vergitterten Loge während der Aufführungen „vernaschte“. Operngenuss mal anders.
Wenn die Duse auf der Bühne Trauben aß
Vom Theater kennen die Goncourts beiläufig Legenden wie Sarah Bernhardt und Eleonora Duse, späterhin Inbegriffe der Divenhaftigkeit. Von der Duse heißt es, sie spiele nur Szenen, „die ihrem Talent entsprechen, während sie in allen anderen, die ihr mißfallen, Trauben ißt oder sich sonst irgendwelchen Zerstreuungen überläßt.“ Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Bei der Bernhardt wiederum lebten, inmitten all der überbordenden orientalisch-japanischen Dekorationen, ein Affe und ein Papagei en famille, wobei der Affe den armen Vogel marterte und peinigte. Doch als man ihn deswegen wegnahm, starb der Papagei fast vor Kummer. Offenkundig eine amour fou, die vielleicht einem Marquis de Sade gefallen hätte, welch Letzterer nur namentlich vorkommt, weil just Flaubert von dessen sexuellen Verstiegenheiten besessen gewesen sei, wie die Goncourts genüsslich mitteilen.
Nicht nur Literaten und Künstler kommen vor, sondern vereinzelt auch Menschen der „niederen Stände“ bis hinab zur Gosse. Als seltsames Zwischenwesen tritt die verkrachte Schauspielerin Suzanne Lagier in Erscheinung, die ständig obszöne Reden schwingt und – um ein Wort von früher zu verwenden – dermaßen „mannstoll“ ist, dass sie sich auch klaglos schlagen lässt und sich allenfalls selbst diverser Verfehlungen bezichtigt, so dass die Herren sie eben rechtmäßig züchtigen dürfen…
Ganz anders bewegend sodann die Passagen, die von Rose handeln, dem langjährigen und mit all ihren Gepflogenheiten vertrauten Dienstmädchen der Brüder. Sie starb einen qualvollen Tod. Erst danach stellte sich heraus, dass sie ein überaus wüstes Doppelleben geführt hatte. Mit heimlich abgezweigtem Geld der Goncourts kaufte sie sich Liebhaber und verfiel aus Kummer dem Suff. Hier hat es ein Ende mit den vielfach sarkastischen Betrachtungsweisen, die Brüder reden von einem Riss in ihrem Leben, von tiefer Trauer. Gleichwohl hat Alain Claude Sulzer in seinem mehrdeutig betitelten Roman „Doppelleben“ (erschienen im August 2022, ebenfalls bei Galiani) die Brüder Goncourt mit dem Schicksal von Rose konfrontiert und den Schluss nahegelegt, sie hätten nicht einmal bemerkt, wie neben ihnen eine Frau jämmerlich zugrunde ging, die sie seit Kindertagen betreut und bedient hatte. Das hört sich nach einem Filmstoff par excellence an.
Ihre Notizen waren gefürchtet
Edmond (1822-1896) und Jules (1830-1870) de Goncourt gelten als Mitbegründer eines eher mitleidlosen, scharf beobachtenden Naturalismus. Sie haben, nach allem, was überliefert ist, wie zuweilen verwechselbare Zwillinge über Jahrzehnte zusammen gelebt und nicht nur ihr Journal, sondern gar ihre Mätressen geteilt. Als charmante Plauderer nahmen sie die Menschen für sich ein, um sich hernach Notizen zu machen und selbige mit diabolischer Könnerschaft auszuformulieren. Manch eine(r) mied sie dann doch, um lieber nicht in ihren Bemerkungen vorzukommen und womöglich zum Gespött der Metropole zu werden. Auch Théophile Gautier argwöhnte: „Sobald man sie nicht anschaut, müssen sie wohl auf ihre Manschetten schreiben.“
Wie auch immer. Amüsante und verblüffende, vielfach auch degoutante Details finden sich in diesem Buch zuhauf. Eine äußerst kurzweilige Klatsch- und Tratsch-Lektüre, die Aspekte einer ganzen Epoche aufschließt. Sinnlichere Geschichts-Exkursionen lassen sich kaum denken.
Edmond und Jules de Goncourt: „Blitzlichter“. Aus den Tagebüchern der Brüder Goncourt. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Anita Albus. Mit bibliographischem Anhang und Register. Galiani Berlin, 352 Seiten. 25 Euro.