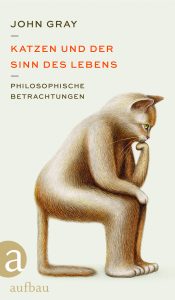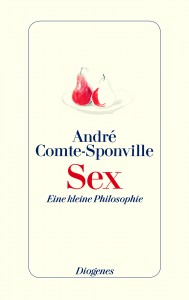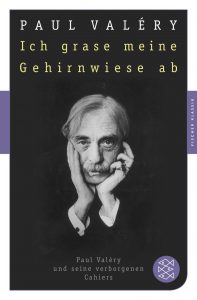Wenn die Weltseele kocht – Phantasien über „Das Zuhause“
Wenn ein Buch „Das Zuhause“ heißt, so lässt sich alltagsnaher Lesestoff erhoffen. Doch der Philosophie-Professor Emanuele Coccia enttäuscht derlei Erwartungen. Er geht stets aufs Ganze und vermischt alles mit allem, bis einem der Kopf schwirrt.
Das Zuhause steht bei Coccia für eine Sphäre, die sich von der Öffentlichkeit und den Städten absetzt, in der die Welt überhaupt erst bewohnbar wird, mithin für einen allgemeinen, recht diffusen Glückszusammenhang, der immer erst noch entstehen muss.
Weitschweifig schildert der Denker, wie er 30 internationale, um nicht zu sagen globale Umzüge hinter sich gebracht hat und schlussfolgert: „Selbst in Momenten des intensivsten Nomadentums werden wir wieder zu einem Zuhause.“ So genau wollten wir es gar nicht wissen.
Sodann führt er seine wildwüchsigen Gedanken spazieren durch Gefilde der Liebe, des Badezimmers, der Schränke und der Mode, der sozialen Medien, der Haustiere, der Wälder und Gärten oder der Küche. Ganz gleich, wo er hindenkt, immerzu wird daraus eine allumfassende Behauptungs-Prosa, in der es jeweils ganz schnell um die gesamte Weltseele an sich geht, mit der er sich halt auszukennen beliebt. Typisch steiles Zitat von Seite 96: „Jedes Zuhause ist ein Akt kosmetischer Chirurgie, eine Alien-Invasion, die exterritoriale Taschen auf dem Planeten erzeugt. Es ist ein Vulkan, der in der alternativen Raumzeit einer nicht-irdischen Realität ausbricht. Das macht das Zuhause zu einem außerirdischen Ort..“ Tja.
Übrigens gehören nach Coccias Ansicht alle Betten auf die Straßen gestellt, auf dass in der Welt ein permanentes Erwachen sei. Und das Schreiben? Ist eine Droge! Es wirkt sich „auf den Geist so ähnlich aus wie eine Nuklearbombe auf den Körper.“ Damit das mal klar ist. Da sehnt man sich als Lesender freilich nach feineren, leiseren Tönen.
Aber wenn es um die Küche und ums Kochen geht, dann wird uns dieser Philosoph doch wohl bei unserer sinnlichen Alltagserfahrung packen? Nun ja, wie man’s nimmt. Zitat von Seite 142: „Es ist das allen Lebewesen innewohnende Feuer, das die Welt kocht. (…) Jede Interaktion mit Lebewesen ist eine Form des Kochens und der Weitergabe von Licht. Jede Erfahrung ist eine Art, zu kochen und uns von der Welt kochen zu lassen. Jeder lebende Körper ist eine Küche der Welt.“ Genug! Wir kapitulieren.
Solche verquasten Passagen erweisen sich auf Dauer als Zumutung, ja, als unerträgliches Geschwätz. Das ganze alchemistische Geraune läuft vage darauf hinaus, dass alles mit allem verschmelzen werde – nicht zuletzt durch das Internet. Mitunter wird die Suada auch unfreiwillig komisch; beispielsweise, indem Coccia sich erinnert, dass er in Berlin eine Dusche in der Küche hatte und diesen Umstand als Beispiel für Weltgestaltung nach dem Muster der menschlichen Anatomie beschwört. Auch sonst hat er es nie eine Nummer kleiner. Sein Weltwirbel muss immer neue Metamorphosen hervorbringen. Widerhall überall. Epochal, planetarisch, universal. So ungefähr.
Eingestreut werden eher banale Erkenntnisse wie jene, dass Identität eine Dauerbaustelle sei oder (Coccia wuchs mit einem Zwillingsbruder auf) dass das gesamte Universum durch zwillingshafte Beziehungen miteinander verbunden sei. Ganz ehrlich: Da lässt sich Karl Valentins erhabenen Weisheiten à la „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ bedeutend mehr abgewinnen.
Emanuele Coccia: „Das Zuhause. Philosophie eines scheinbar vertrauten Ortes“. Hanser Verlag, 160 Seiten. 22 Euro.