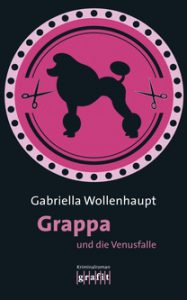Vor zehn Jahren starb die „Rundschau“ – ohne Rettungsversuch

Kurz vor Ende eines Spätdienstes entstanden und Jahre danach unversehens vielsagend: der leere Newsdesk der Westfälischen Rundschau in Dortmund – mit fertiggestellten Seiten auf der Bildschirmwand, aufgenommen im Jahr 2009. (Foto: Bernd Berke)
Beängstigend rasende Zeit: Zehn Jahre soll das schon wieder her sein, dass am 15. Januar 2013 die damalige WAZ-Gruppe (heute Funke-Mediengruppe) das faktische „Aus“ für die Westfälische Rundschau (WR) verkündet hat?
Zur Erinnerung: Danach ging alles ganz schnell – oder auch quälend langsam; je nach Perspektive. Denn die kurzerhand Entlassenen mussten noch volle zwei Wochen das totgesagte Blatt machen. Nach dem 31. Januar 2013 erschien die einst so stolze und weit verbreitete Dortmunder Zeitung nur noch als Phantom-Publikation oder „Zombie-Zeitung“, nämlich gänzlich ohne eigene Redaktion, wenn man vom zunächst einsam weiter (als „König Ohneland“) amtiert habenden Chefredakteur Malte Hinz absieht.
Die Seiten wurden fortan von der WAZ (Mantelteil) sowie, was Dortmund anbelangt, von den vormals konkurrierenden Ruhrnachrichten (Lokalteil) befüllt und nur noch kosmetisch auf WR-Look getrimmt. Bis dahin hatte die Rundschau auch mit den anderen Zeitungen der WAZ-Gruppe (Westfalenpost, Westdeutsche Allgemeine Zeitung) einigermaßen heftig im Wettbewerb gestanden. Seit der WR-Schließung war jedoch häufig dieser Effekt zu beobachten: Fehlt ernsthafte Konkurrenz, so verloddern mitunter die journalistischen Sitten. Man hat’s ja nicht mehr nötig.
Verlust für die publizistische Landschaft
Es war ein großer Verlust für die publizistische Landschaft (und somit für die demokratische Meinungsbildung) in Westfalen und eine persönliche Tragödie für manche Kolleginnen und Kollegen, die auf einmal ohne Job waren. Von Beruf, Berufung und Herzblut gar nicht erst zu reden. Es ging ja nicht nur um rund 120 festangestellte Redakteurinnen und Redakteure, sondern auch um etwa 180 freie Mitarbeiter(innen) zwischen Dortmund, Hagen, Lünen, Schwerte, Unna und Siegen, Lüdenscheid, Altena, Gevelsberg, Arnsberg, Meschede und Olpe. Um nur einige Standorte zu nennen.
In früheren Zeiten hatte das Verbreitungsgebiet gar nordwärts bis ins Emsland, weit ins westliche Ruhrgebiet und – rings um Betzdorf – bis in einen nördlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz gereicht. Da knüpfte die Westfälische Rundschau beinahe wieder an die große Tradition des Dortmunder Vorläufers „Generalanzeiger“ an, der vor 1933 die auflagenstärkste deutsche Zeitung außerhalb Berlins gewesen war – bis die Nazis ihn mundtot machten.
Aber kommen wir auf 2013 zurück. Gewiss, vor allem einige Jüngere haben sich nach der „Freisetzung“ beruflich neu erfunden, gelegentlich mit staunenswertem Erfolg. Doch wer bereits über 50 war, hatte meist zu kämpfen. Ich will nicht nachträglich unken, aber: Seit 2013 sind recht viele ehemalige WR-Leute verstorben; nicht auszuschließen, dass hie und da auch nagender Kummer über die abrupt abgerissene berufliche Laufbahn und die hinterrücks entwertete Lebensleistung übel mitgespielt hat. Niemand kann es wissen.
Die Redaktion als weit verzweigter Organismus
Es mag sein, dass ein Teil der Leserschaft sich ebenso rasch wie sang- und klanglos umorientiert hat. Es gab ja schon vorher diese Cleverles alias treulose Abo-Hopper, die in regelmäßigen Abständen die Zeitung wechselten und dabei jeweils Willkommens-Prämien einheimsten. Vielen aber war – auch, aber nicht nur aus politischen Gründen – die WR speziell ans Herz gewachsen. Ich persönlich (und nicht nur ich) halte immer noch dafür, dass „wir“ redaktionell insgesamt besser waren als z. B. die Ruhrnachrichten oder – weiter südwärts – als die „Siegener Zeitung“. Fragen der Wirtschaftlichkeit stehen freilich auf einem anderen Blatt.
Noch heute erfasst einen das Weh, wenn man über Jahrzehnte dabei gewesen ist und beispielsweise weiß, wie weit früher das eigene Korrespondentennetz der Rundschau gespannt war, wie denn überhaupt mit der Zeitung ein ganzer Organismus verendet ist. Die Westfälische Rundschau hat übrigens auch journalistische Prominenz hervorgebracht – vom nachmals fernsehbekannten Ernst Dieter Lueg über den späteren NRW-Ministerpräsidenten, Bundeswirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement bis hin zu Hans Leyendecker, dem bundesdeutschen Investigativ-Reporter schlechthin. Mehr noch: Erste Schritte ins Leben als exponiert Schreibende haben bei der WR z. B. auch Navid Kermani (nun einer der wichtigsten Publizisten dieses Landes) und Anna Mayr (heute gefragte Autorin der „Zeit“) getan. Kermani hat in der Lokalredaktion Siegen angefangen, Mayr in der Lokalredaktion Unna. Da rede noch jemand von „Provinz“.
_______________________________________________
Machtdemonstration der Konzernchefs?
Der nordrhein-westfälische Zweig des Deutschen Journalistenverbands (DJV-NRW) hat zum Jahrestag der WR-Schließung bzw. Redaktions-Entlassung einen Podcast produziert, in dem die eben erwähnte Anna Mayr sowie Barbara Merten-Kemper (langjährige Betriebsrätin der WAZ) und Lars Reckermann (in den finalen Jahren der WR stellvertretender Chefredakteur) Rückschau halten und Ausblicke wagen.
Eine Lesart läuft darauf hinaus, dass die schockierende Maßnahme wohl eine Machtdemonstration der Konzernleitung gewesen sei – ein Exempel mit Drohpotenzial gegen etwaige Rebellen. Als aufsässig hätten zumal die WR-Redaktionen gegolten, ein Geschäftsführer sei damals als notorischer Rundschau-Hasser verschrien gewesen. Reckermann wählte folgenden Vergleich: Die WR sei stets die linke „Malocher-Zeitung“ gewesen, sozusagen das Schimanski-Blatt, während die WAZ wie James Bond aufgetreten sei. Nun ja. Ich habe mir 007 immer ein klein wenig anders vorgestellt.
Die Auflage war gar nicht so schlecht
Einig war man sich in der Ansicht, dass die WR mit gutem Willen und Fortune durchaus hätte gerettet werden können. Zum Zeitpunkt der Schließung hatte sie immerhin noch eine Auflage von cirka 115.000 Exemplaren – eine ansehnliche Zahl, über die sich heute beispielsweise der bundesweit trommelnde „Tagesspiegel“ oder die „Welt“ freuen würden. Engagierte Verleger der alten Schule hätten unter solchen Voraussetzungen nichts unversucht gelassen…
Geradezu erschütternd ist, woran Barbara Merten-Kemper sich erinnert. Manfred Braun, zur fraglichen Zeit einer von drei Geschäftsführern der WAZ-Gruppe, habe ihr später – an seinem allerletzten Arbeitstag – gestanden, dass die WR-Demontage ein „Fehler“ gewesen sei. Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dies erst zum Abschied zuzugeben. Merten-Kemper sagt, sie sei fassungslos gewesen und habe ihn gefragt, warum er all die Jahre über nichts getan habe, um die Entscheidung zu revidieren. Da musste er passen.
Medien brauchen die besten Leute
Seinem vorwärts strebenden Naturell entsprechend, schlug Lars Reckermann (zwischenzeitlich Chefredakteur der Nordwest-Zeitung in Oldenburg, jetzt Chef bei der Schwäbischen Post) ein paar optimistische Töne an. Die Funke-Mediengruppe habe sich mit der Zeit ein besseres Image zugelegt als einst die WAZ-Gruppe – und überhaupt sei der Journalismus in den letzten Jahren generell deutlich besser geworden. Dem möchte ich nur bedingt beipflichten. Anna Mayr wünscht sich unterdessen noch mehr: Die allerbesten Leute der kommenden Jahrgänge sollten möglichst ins Zeitungsgewerbe gehen. Ein schöner Traum. Doch auch andere Branchen brauchen besondere Talente.
___________________________________________
P. S.: Dies ist beileibe nicht der erste Revierpassagen-Beitrag zur WR-Schließung. Früher sind beispielsweise schon erschienen:
https://www.revierpassagen.de/22807/ein-jahr-nach-schliesung-der-rundschau-redaktion-die-folgen-schmerzen-noch/20140115_2138
https://www.revierpassagen.de/47988/heute-vor-fuenf-jahren-das-ende-der-rundschau/20180115_1637
Wird all das hintereinander gelesen, so mögen sich Redundanzen ergeben, aber was soll’s. Nehmt es als Chronologie eines allmählichen Verschwindens.
Hier noch ein Link zum Podcast des DJV-NRW (Moderation: die freie Journalistin Sascha Fobbe): https://www.youtube.com/watch?v=q0GTb3PbQkU