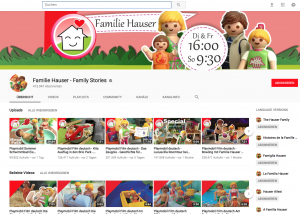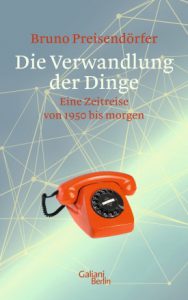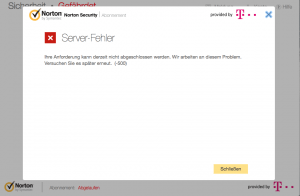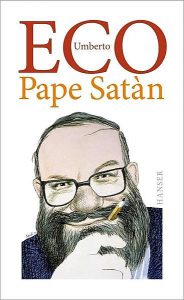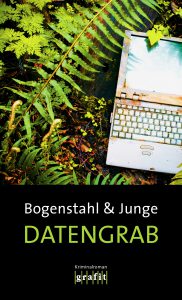Fürwahr, die Skulptur Projekte in Münster machen sich äußerst rar. Mit ihrem zehnjährigen Rhythmus (bislang: 1977, 1987, 1997, 2007) kommen sie an diesem Wochenende gerade mal in fünfter Auflage heraus. Damit verglichen, ist selbst die Kasseler documenta (die gleichfalls just jetzt startet) mit ihren Fünfjahres-Abständen eine nahezu inflationäre Veranstaltung.

Skulpturen von grundsätzlich verschiedener Art: Soll der von Cosima von Bonin aufgestellte Lastwagen etwa die Plastik von Henry Moore (Teilansicht links) abholen? Die Antwort lautet, entgegen dem bedrohlichen Anschein: Nein! (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Bernd Berke)
Scherz beiseite und dem Mann der ersten Stunde die Ehre: Seit Anbeginn ist der große Spritus rector der Skulptur Projekte, Prof. Kasper König, wegweisend dabei; ursprünglich im Verein mit dem Miterfinder Klaus Bußmann, diesmal flankiert von den beiden Kuratorinnen Britta Peters und Marianne Wagner.
Das Prinzip ist gleich geblieben: Künstler(innen) – anfangs waren es ausschließlich Männer – werden nach Münster eingeladen, wo sie sich mit Orten ihrer Wahl auseinandersetzen und Projektvorschläge einreichen. Damit beginnt ein langwieriger Prozess bis zur Realisierung. Rund drei Dutzend neue künstlerische Orts-Umschreibungen sind diesmal entstanden. Hinzu kommen etwa ebenso viele Skulpturen, die von früheren Projekten übrig geblieben sind. Mit anderen Worten: Es lagern sich von Mal zu Mal gleichsam immer neue Zeit-Schichten mit anderen ästhetischen Valeurs an. Daraus ergibt sich eine hochinteressante Historie.
Interventionen im Stadtbild
Auch 2017 stiften – unter gesellschaftlich veränderten Vorzeichen – die Künstler an einigen Orten der Stadt wieder erhellende Widersprüche, Einsprüche, Korrespondenzen, Assoziationen und was dergleichen Fühl- oder Denkanstöße mehr sind. Mal sind die Interventionen im Stadtbild erst allmählich wahrnehmbar, mal kommen sie mit weiter ausholenden Gesten oder überfallartig daher.
Man mag sich das alles, versehen mit einem speziellen Stadtplan oder per Navigations-App, in aller Ruhe erlaufen oder münstertypisch erradeln. Da kein Eintritt erhoben wird (man kann ja den Zugang zur Stadt schwerlich mit einer Gebühr belegen), sollte man getrost auch mehrmals wiederkommen. Und mit kundiger Führung hat man eventuell mehr von alledem.
Im Zeichen der digitalen Welt
Was ist mit den veränderten Vorzeichen gemeint? Selbstverständlich vor allem die seit 2007 noch einmal erheblich vorangeschrittene Digitalisierung und Globalisierung unseres Lebens. Auf solche umwälzenden Veränderungen, das war klar, mussten auch die Skulptur Projekte antworten und reagieren, wenn auch längst nicht immer explizit oder gar „eins zu eins“ abbildend. Das wäre denn doch zu simpel.

Im Münsteraner Hafen übers Wasser gehen: Ayse Erkmen, „On Water“. (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Henning Rogge)
In der heißen Arbeitsphase, also seit etwa zweieinhalb Jahren, kristallisierten sich in zahllosen Diskussionen die Befragung von Ort, Zeit und Körperlichkeit im digitalen Zeitalter als Leitthemen heraus. So manches, was derzeit ringsumher geschieht, könnte ja auf eine Auflösung von Raum, Zeit und Leiblichkeit hinauslaufen. Und wenn schon der Körper in Spiel kommt, ist es nicht nur der unbewegte. Der Performance als Gattung an der Grenze zur darstellenden Kunst kommt diesmal besondere Bedeutung zu.
Ein von jeher gültiges Thema stellt sich zudem in größerer Schärfe als ehedem: die Schaffung und Behauptung von öffentlichen, also nicht privat vereinnahmten Plätzen. Und zum Faktor Zeit: Manche Werke sind ganz bewusst darauf angelegt, nur temporär vorhanden zu sein, also allmählich zu vergehen oder schließlich abrupt zu verschwinden.
Mächtiger Truck und eine Wasserwaage am Museum
Jetzt aber endlich zu ein paar konkreten Beispielen, wie sie bei einer zweistündigen Presseführung vor der Eröffnung zu erleben waren:
Auf dem Vorplatz des LWL-Museums für Kunst und Kultur hat die Künstlerin Cosima von Bonin einen wahrhaft monumentalen Truck geparkt, auf dem sich ein großer schwarzer Container ihres Kollegen Tom Burr befindet, die ganze Chose heißt denn auch alliterierend „Benz Bonin Burr“. Es sieht ganz so aus, als solle mit dem Lastwagen demnächst die schon „klassische“ Skulptur von Henry Moore abtransportiert werden, die dort steht. Tatsächlich war es vor Ort ein Thema, ob Moores Arbeit während der Skulptur Projekte dort verbleiben dürfe.

Kein Bestandteil der Skulptur Projekte, aber umstrittenes Lokalgeschehen, auf das Bezug genommen wird: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat sein Buchstaben-Logo am LWL-Museum für Kunst und Kultur direkt auf eine Fassadenarbeit von Otto Piene aufgesetzt. (Foto: Bernd Berke)
Zugleich verweist die riesige Truck-Installation indirekt auf ein Problem an der Fassade des Landesmuseums. Dort hat der Landschaftsverband LWL sein Dreibuchstaben-Logo direkt auf eine Arbeit von Otto Piene aufgesetzt, der dies wohl unter mehr oder weniger sanftem Zureden akzeptiert hat. Sein eigentlich urheberrechtlich geschütztes Werk ist jedenfalls am Rande verfälscht worden.
Auf der anderen Seite des Museums, am Domplatz, geht es unscheinbarer her. Dort hat John Knight eine Wasserwaage an das Gebäude angesetzt, als wolle er erneut Maß nehmen oder etwas ins Lot bringen. Ganz buchstäblich könnte man von einer künstlerischen „Maßnahme“ sprechen, die sich innig auf die Architektur bezieht.
Die Privatwohnung des Herrn N. Schmidt
Im Innern des öffentlichen Museums hat Gregor Schneider quasi eine Privatwohnung eingebaut, die man (jeweils höchstens zu zweit) durch einen Seiteneingang erreicht. In diesem Wohnraum ist ein gewisser „N. Schmidt“ daheim. Eine Kollegin versichert, ihr sei – nach eineinhalb Stunden Wartezeit in der Schlange – drinnen Gregor Schneider höchstselbst begegnet, aber eher wie ein Geist. Man lasse sich überraschen. Auch Enttäuschungen sind nicht ausgeschlossen.
Koki Tanaka hat in einem Gebäude der Johannisstraße seine „Provisional Studies“ aufgebaut. In unwirtlich gekachelten Räumen zeigt er Videos von einem Workshop, an dem acht Bewohner(innen) Münsters von ganz unterschiedlicher Herkunft teilgenommen haben. Ein „Dschungelcamp“ für Intellektuelle? Das nun doch beileibe nicht. Die intensive Begegnung stand unter der Frage „How to live together?“ Es geht also ums Zusammenleben an und für sich. Eine raumgreifende, begehbare „Skulptur“, die den ohenhin längst fließend gewordenen Gattungsbegriff beherzt erweitert.

Parodistisches Spiel mit der typischen Münsteraner Giebelform: begehbare Arbeit „Sculpture“ von Pelese Empire, wohinter sich Barbara Wolff und Katharina Stöver verbergen. (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Bernd Berke)
Anspielung auf die Giebelform
Schon eher der konventionellen Vorstellung von Skulptur bzw. Architektur enspricht die Arbeit von Pelese Empire (Barbara Wolff / Katharina Stöver). Sie heißt schlicht und einfach „Sculpture“ und greift parodierend und anverwandelnd die in Münster so häufige Giebelform auf, außerdem wurde das erschröcklich-bizarre rumänische Karpatenschloss Peles auf die Außenhaut projiziert. Auch diese Skulptur kann man betreten, sie enthält sogar eine Bar und kann zum Begegnungsort mutieren. Insgesamt kommt diese bauliche Skulptur auch als eine Art „Fake“ daher und greift somit ein politisch virulentes Thema der Internet-Ära auf.
Wenn man so will, ist das Projekt von Justin Matherly noch skulpturenförmiger. Er hat ein Gebilde geformt, das dem Nietzsche-Felsen im schweizerischen Sils Maria nachempfunden ist. Dieser Felsen soll den Philosophen zur Idee einer „ewigen Wiederkunft des Gleichen“ angeregt haben. Eine Figuration mit Hintergedanken, die man kennen muss, um das Ganze zu würdigen. Der sehr brüchig wirkende „Fels“ ist übrigens innen hohl und steht auf seltsamen Stützen. Es handelt sich um medizinische Gehhilfen.

Wird nach der Ausstellung vernichtet: Lara Favarettos „Momentary Monument“. (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Bernd Berke)
Rein äußerlich betrachtet, hat auch Lara Favaretto ein steinernes Monument nach herkömmlichem Verständnis geschaffen. Doch weit gefehlt. Wir unterliegen einer kunstvollen Täuschung. Auch dieses scheinbar so massive Werk ist innen hohl, es hat sogar einen Schlitz zum Geldeinwurf (der Erlös kommt Menschen in Abschiebhaft zugute). Das „Momentary Monument“ ist, wie der Titel ahnen lässt, nicht auf Dauer angelegt, sondern soll mit Ende der Skulptur Projekte geschreddert und recycelt werden. Einstweilen aber bezieht es sich als Gegenüber und kritischer Gegenentwurf auf ein kolonialistisches Ehrenmal vis-à-vis.
Subtile Geste vor dem Erbdrostenhof
Im berühmten Erbdrostenhof (barockes Palais) haben bei früheren Skultur Projekten Richard Serra und Andreas Siekmann ihre unübersehbaren Zeichen gesetzt, Letzterer mit einer Arbeit, die sich über städtische Tier-Maskottchen mokierte und bei Stadtwerbern nicht allzu gut ankam. Serras Arbeit hätten die Münsteraner hingegen liebend gern behalten, doch sie wurde zu ihrem Leidwesen für gutes Geld in die Schweiz verkauft.

Trotz der Größe ungeahnt feingliedrig: „Beliebte Stellen“ von Nairy Baghramian vor dem Erbdrostenhof. (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Bernd Berke)
Ein Platz mit alter und neuerer Vorgeschichte also, der beispielhaft zeigt, wie bestimmte Stätten insgeheim nachhaltig durch die Projekte geprägt werden, selbst dann, wenn die Einzelwerke nicht mehr am Ort sind. Genau hier findet sich nun die eher zurückhaltende Arbeit „Beliebte Stellen“ von Nairy Baghramian, die den Raum gleichwohl neu „besetzt“. Ihre Skulptur windet sich als große, doch feine und aparte Geste über den Platz, sie ist – ganz planvoll – „unfertig“ und müsste noch verschweißt werden, auch wirkt die stellenweise tropfenförmige Oberfläche ganz so, als sei sie noch im Werden (oder schon im Vergehen). Ein Beispiel dafür, wie man äußerlich „groß“ agieren und dennoch subtil bleiben kann.
Übers Wasser gehen und sich am „Lagerfeuer“ versammeln
Ein paar spektakuläre Ortsbezüge kenne ich (noch) nicht aus eigener Anschauung, man kann sich jedoch anhand der Beschreibungen schon Vorfreude bereiten: Für „On water“ (Auf dem Wasser) hat Ayse Erkmen am Münsteraner Hafen knapp unter der Wasseroberfläche einen Steg gebaut, auf dem Besucher sozusagen übers Wasser gehen können – jedenfalls beinahe. Wer jetzt an Christo und den Lago d’Iseo denkt, liegt vielleicht nicht völlig daneben.

Am „Lagerfeuer“ des digitalen Zeitalters: Aram Bartholl, „5 V“ (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Henning Rogge)
Auf andere Art staunenswert ist der Beitrag von Aram Bartholl, der geheimnisvolle thermoelektrische Apparaturen ersonnen hat, so dass man an einer Art Lagerfeuer wirklich und wahrhaftig den Akku seines Smartphones aufladen kann. Dieser Vorgang soll zwar ziemlich lange dauern, erzeugt aber sicherlich ein besonderes Gemeinschaftserlebnis und verknüpft älteste mit neuesten Erfahrungen der Menschheit.
Dependance in der Revierstadt Marl
Mit dem Ruhrgebiet hat all das aber nichts zu tun, oder? Wie man’s nimmt. Die Skulptur Projekte haben diesmal unter dem Titel „The Hot Wire“ (Der heiße Draht) einen „Ableger“ in Marl, wo rund ums Skulpturenmuseum Glaskasten schon seit langer Zeit Kunst im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle spielt.

Im Austausch von Marl nach Münster gelangt: Ludger Gerdes‘ vielsagender, sparsam „illustrierter“ Schriftzug. (© Skulptur Projekte 2017 / Foto: Bernd Berke)
Marl ist ein harsches Gegenstück zu Münster, nach dem Krieg entstand hier ein künstliches Stadtzentrum in teilweise brutal anmutender Moderne, während man im eher lieblichen Münster bekanntlich Teile der Altstadt rund um den Prinzipalmarkt wieder aufgebaut hat.
Folglich haben Skulpturen in Marl auch eine ganz andere Funktion. Dort gilt es jedenfalls nicht in erster Linie, womöglich konservative Strukturen aufzubrechen. Aber inzwischen sind ja auch viele Leute in Münster mental weiter.
Die Autonomie und der touristische Faktor
Zurück nach Münster. Längst sind die dortigen Skulptur Projekte auch zum touristischen Magneten geworden. Bei der Eröffnungspressekonferenz, zu der mehrere Hundertschaften von Medienvertretern angerückt waren, schwärmte denn auch Münsters OB Markus Lewe geradezu euphorisch, man sehe sich nunmehr wieder in einer Reihe mit Kassel (documenta) und Venedig (Biennale), gern auch in einer Abfolge mit Münster an der Spitze…
Gegen derlei wohlmeinende, doch auch begehrliche Vereinnahmung müsste man sich fast schon wieder wehren und auf künstlerische Autonomie, wenn nicht gar Sperrigkeit pochen. Doch die allermeisten Objekte und Installationen der Skulptur Projekte entziehen sich auch so schon der bloßen „Eventisierung“ und erst recht der schnöden Indienstnahme.
Gleichwohl sind die Skulptur Projekte nach etlichen Skandalen und Skandälchen der frühen Jahre (als sich die bürgerlich geprägte Stadt über vieles erregte, was heute selbstverständlich anmutet) etabliert und in gewisser Weise auch populär – freilich alles andere als „populistisch“. Inzwischen finden sich, neben den Hauptträgern (Stadt Münster und Landschaftsverband Westfalen-Lippe / LWL), etliche potente Sponsoren, die das Budget heuer nahe an die Acht-Millionen-Grenze hieven.
Skulptur Projekte Münster. Vom 10. Juni bis zum 1. Oktober 2017.
Offizielle Öffnungszeiten Mo bis So 10-20, Fr 10-22 Uhr. Freier Eintritt. Katalogbuch (430 Seiten) 15 Euro.
Allgemeine Infos:
www.skulptur-projekte.de
Tel. 0251 / 5907 500
Infos zu Touren und Workshops (auch Online-Buchung möglich unter www.skulptur-projekte.de): 0251 / 2031 8200, Mail: service@skulptur-projekte.de
Navigations-App zu den Werken: apps.skulptur-projekte.de