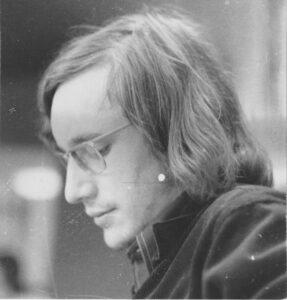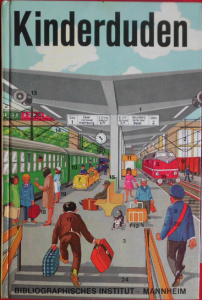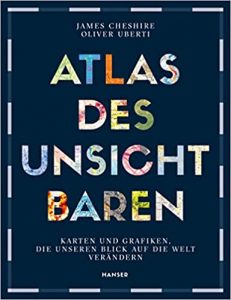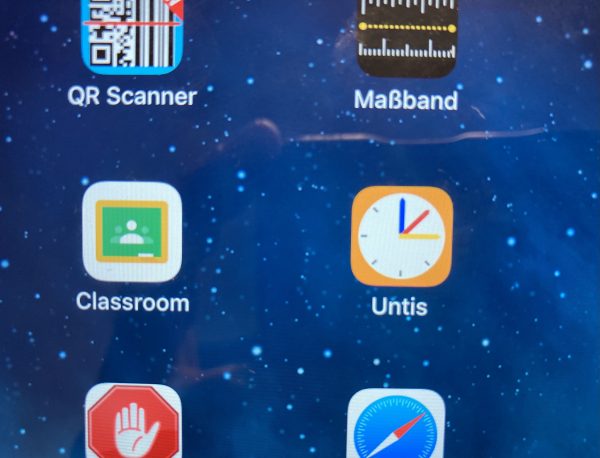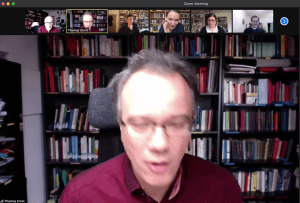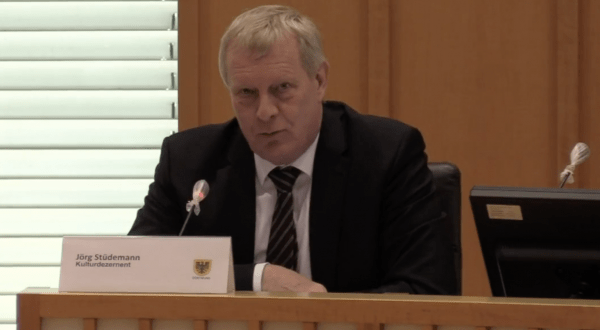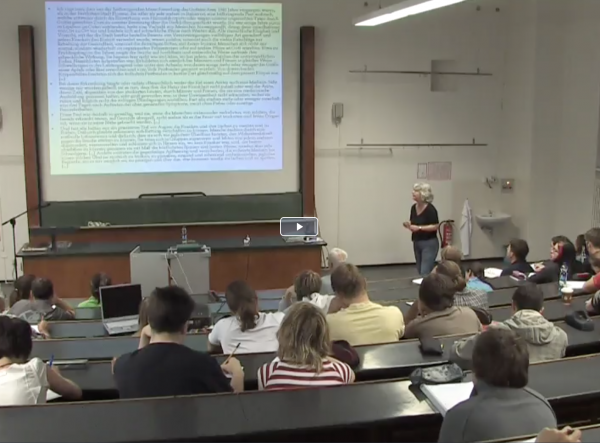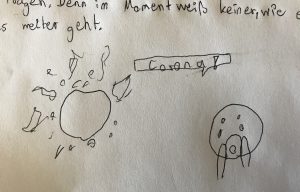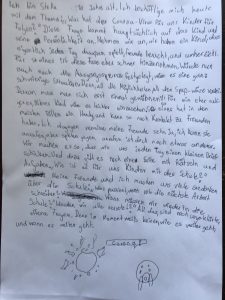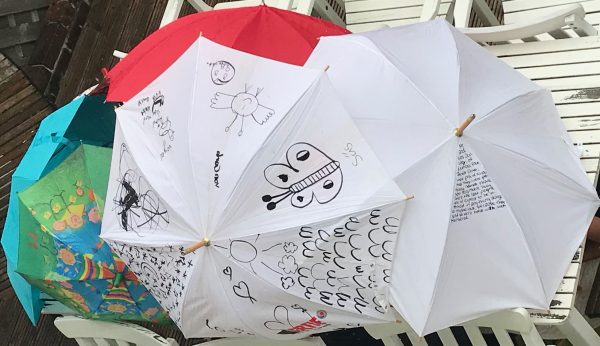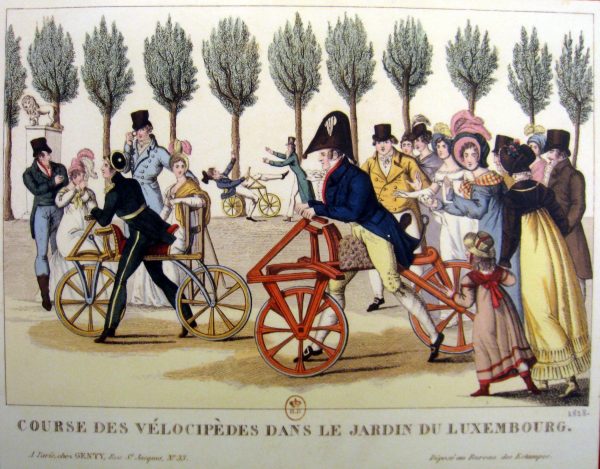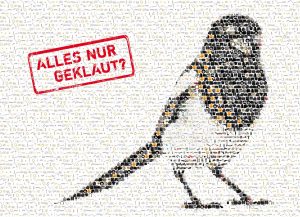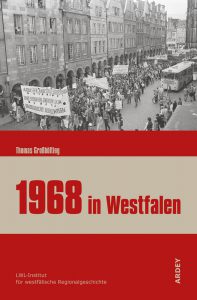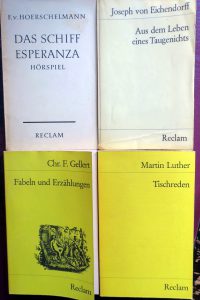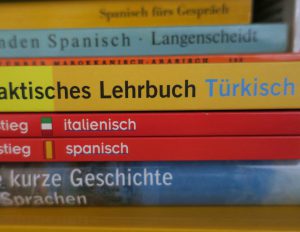Wohl unter „M“ einzuordnen: in diesen Tagen ratsame bzw. pflichtgemäße Mund-Nasen-Bedeckungen. (Update: Achtung, Achtung! Solche Stoffexemplare sind mittlerweile durch medizinische Masken zu ersetzen). (Foto: BB)
Hier ein kleines Corona-„Lexikon“, darinnen etliche Worte, Wendungen, Zitate, Namen und Begriffe, von denen wir zu Beginn des Jahres 2020 nicht einmal zu träumen gewagt haben; aber auch bekannte Worte, die im Corona-Kontext anders und häufiger auftauchen, als bislang gewohnt. All das zumeist ohne Definitionen und Erläuterungen, quasi zum Nachsinnen, Ergänzen und Selbstausfüllen. Und natürlich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, aber von Zeit zu Zeit behutsam ergänzt. Vorschläge jederzeit willkommen.
Dazu ein paar empfehlende Hinweise: Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hat sich einige Wochen lang in einer Serie mit den sprachlichen Folgen der Corona-Krise befasst, hier ist der Link.
Eine mit derzeit (März 2021) rund 1200 Einträgen sehr umfangreiche Liste von Corona-Neologismen hat das in Mannheim ansässige Leibniz-Institut für Deutsche Sprache online gestellt. Bitte hierher.
Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) hat ein umfangreiches Corona-Glossar veröffentlicht, dazu bitte hier entlang.
Ein Glossar zum phänomenalen NDR-Podcast mit Prof. Christian Drosten und Prof. Sandra Ciesek findet sich hier.
Einige weitere Erklärungen hat die Zeitschrift GEO gesammelt, und zwar hier.
In ihrer Ausgabe vom 4. Januar 2021 (!) ist die „Süddeutsche Zeitung“ in Person des Autors und Dramaturgen Thomas Oberender schließlich auch auf den Trichter gekommen und bringt unter der Zeile „Die Liste eines Jahres“ eine recht umfangreiche Wortsammlung. Daraus habe ich mir auch ein paar Ausdrücke genehmigt. Oberender darf sich wiederum hier bedienen.
Nun aber unsere Liste der Wörter, Wendungen und Namen:
1,5 Meter Abstand
2 Meter Abstand
2-G-Regel („geimpft oder genesen“)
2-G-plus („geimpft oder genesen und getestet)
3-G-Regel („geimpft, genesen, getestet“)
3-G-plus (nur mit PCR-Test, nicht mit Antigen-Text)
6-Monats-Abstand (bzw. 3, 4 oder 5 Monate – zwischen Zweitimpfung und „Boostern“)
7-Tage-Inzidenz
15-Minuten-Regel (Gesprächsdauer, die das Risiko begrenzt)
15 Schüler(innen) im Klassenraum
15-Kilometer-Radius (um den Wohnort)
20 Quadratmeter pro Kunde (in größeren Geschäften ab 26.11.2020)
21 Uhr (Ausgangssperre)
23 Uhr (Sperrstunde)
-70 Grad (erforderliche Kühlung des BioNTech-Impfstoffs)
800 Quadratmeter (Verkaufsfläche)
50.000 Arbeitsschritte (zur Produktion des BioNTech-Impfstoffs)
100.000 Einwohner (Maßzahl zur Inzidenz)
Absagen
absondern
Abstand
Abstrich
achthundert Quadratmeter (Verkaufsfläche)
Adenoviren
Aerosol
Aerosolbildung
AHA-Formel (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske)
AHA-Regeln
AHA+L (…plus Lüften)
Akkolade (französ. Wangenkuss-Begrüßung, nunmehr verpönt)
Alkoholverbot
#allesdichtmachen (umstrittene Schauspieler-Aktion)
#allesschlichtmachen
„Alles wird gut!“
Allgemeinverfügung
Alltagsmaske
Alpha (neuer Name für britische Mutante)
Altenheime
Alterskohorte
Aluhut
„an Corona“ (verstorben – vgl.: „mit Corona“)
„andrà tutto bene“
Antikörper
Antikörpertest
App (zur Nachverfolgung)
Armbeuge (Hust- und Nies-Etikette)
AstraZeneca (Impfstoff-Hersteller)
asymptomatisch
„auf dünnstem Eis“ (Merkel)
„aufgrund der aktuellen Umstände“
„auf Sicht fahren“
aufsuchende Impfung
Ausgangssperre
Autokino (Renaissance)
AZD1222 (Impfstoff von AstraZeneca)
AZD7442 (Medikament von AstraZeneca)
B.1.1.7 (britische Mutation des Corona-Virus / Aplha)
B.1.1.28.1 – P.1 (brasilianische Mutation)
B.1.1.529 (neue südafrikanische Variante, November 2021)
B.1.351 (südafrikanische Mutation)
B.1.526 (New Yorker Mutation)
B.1.617 (indische Mutation / Delta)
BA.2 (BA.1, BA.3) Subtypen der Omikron-Variante
Balkongesang
Balkonklatscher
Bamlanivimab (Antikörper-Medikament)
„Bazooka“ (massive Geldmittel – laut Olaf Scholz)
Beatmung
Beatmungsgerät
bedarfsorientierte Notbetreuung (Kita)
Beherbergungsverbot
behüllte Viren
Bergamo
„Bergamo ist näher, als viele glauben.“ (Markus Söder, 13.12.2020)
Bernhard-Nocht-Institut
Besuchsverbot (Alten- und Pflegeheime)
Beta (neuer Name für südafrikanische Mutante / B.1.351)
Bfarm-Liste (Auflistung der Antigen-Tests)
Bildungsgerechtigkeit
„Bild“-Zeitung (Kampagne gegen Drosten etc.)
Biontech / BioNTech (Impfstoff-Hersteller)
Black-Swan-Phänomen
Blaupause, keine
„Bleiben Sie gesund“ (Grußformel)
Blitz-Lockdown (vor Weihnachten/Silvester 2020)
Blutgerinnsel
BNT 162b2 (Biontech-Impfstoff)
Böller-Verbot
Booster
Booster-Impfung
boostern
Bremsspur („Das Virus hat eine unglaublich lange Bremsspur“ – Jens Spahn)
Brinkmann, Melanie (Helmholtz-Zentrum, Braunschweig)
„Brücken-Lockdown“ (Armin Laschet am 5. April 2021)
Bundesliga (Geisterspiele etc.)
Bundesnotbremse
Buyx, Alexa (Vorsitzende Deutscher Ethikrat)
C452R (Teil der indischen Doppelmutante)
CAL.20C (kalifornische Mutante)
case fatality
Casirivimab (Antikörper-Medikament)
Celik, Cihan (Leiter der Covid-Station am Klinikum Darnstadt)
China
Chloroquin
Ciesek, Sandra (Virologin, Frankfurt/Main)
Click & collect (Bestellung und Abholung)
Click & meet (Shoppen mit Termin)
Comirnaty (Handelsname des Biontech-Impfstoffs)
Contact Tracing
COPD (Lungenkrankheiten)
Corona
Corona-Ampel
coronabedingt
Corona-Biedermeier
Corona-Bonds
Corona-Blues
Corona-Chaos
Corona-Deutschland
„Corona-Diktatur“
Corona-Ferien
coronafrei
coronahaft
Corona-Gipfel
Corona-Hilfsfonds
Corona-Hotspot
Corona-Kabinett
Corona-Krise
Corona-Koller
Corona-Müdigkeit
Corona-Mutation
Corona-Notabitur
Corona-Pandemie („Wort des Jahres“ 2020)
Corona-Panik
Corona-Party
Corona-Schockstarre
Corona-Skeptiker
Corona-Tagebuch
Corona-Ticker
Corona-Verdacht
Corona-Winke (Gruß aus der Distanz)
Corona-Zoff
Coronials („Generation Corona“)
coronig
coronös
„Corontäne“ (Quarantäne wg. Corona)
Corozän (Corona-Zeitalter)
Cove (Impfstoff von Moderna)
Covid-19
Covidioten (Hashtag / siehe Verschwörungstheoretiker)
CovPass (App)
CureVac (Impfstoff-Hersteller)
Datenschutz (bei der Corona-Warn-App)
„Dauerwelle“
Decke auf den Kopf („Mir fällt die…“)
Dekontamination
Delta (neuer Name für die indische Mutante)
Delta Plus (Variante der Variante: B.1.617.2.1)
Desinfektion, thermische
Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel spritzen (Trump)
„Deutschland macht sich locker“
Dezemberhilfe(n)
Digitaler Impfnachweis
Digitaler Unterricht
„Distanz in den Mai“ (statt „Tanz in…“)
Distanzschlange
Distanzunterricht
Divi-Intensivregister
„Doppelmutante“ (indische Mutation, laut Prof. Drosten irreführender Begriff)
„dorfscharf“ (lokale Grenzziehungen beim Lockdown)
dritte Welle (befürchtet im Frühjahr 2021)
Drittimpfung
Drive-in-Test
Drosten, Christian (Charité, Berlin)
Drosten vs. Kekulé
durchgeimpft
Durchseuchung
E484Q (Teil der indischen Doppelmutante)
Ebola
Eindämmung
eineinhalb Meter (Abstandsregel)
eingeschränkter Pandemiebetrieb
eingeschränkter Regelbetrieb
Einreisestopp
„Einsperr-Gesetz“ (Ausgangsbeschränkungen laut „Bild“-Zeitung)
Einweghandschuhe
E-Learning
Ellbogencheck (Corona-Gruß)
Ema (Europäische Arzneimittel-Agentur)
Epidemie
Epidemiologie
„Epidemische Lage (von nationaler Tragweite)“
„Epidemische Notlage nationaler Tragweite“
Epizentrum
Epsilon (Virus-Variante B.1.427 / B.1.429)
Erntehelfer
Erstgeimpfte
Eta (Virus-Variante B.1.525)
Etesevimab (Antikörper-Medikament)
Exit-Strategie
exponentiell (Wachstum)
Falk, Christine (Präsidentin Dt. Gesellschaft für Immunologie, Hannover)
Fallsterblichkeit
Fallzahlen
fatality
Fatigue
Fauci, Anthony (US-Virologe)
Fax (Kommunikations-Instrument mancher Gesundheitsämter)
„…feiert keine stille Weihnacht.“ („Das Virus feiert…“ / Olaf Scholz am 13.12.2020)
Ffp2
Ffp3
flatten the curve
Fledermaus
Fleischfabriken
Flickenteppich (Föderalismus)
Fluchtmutation
forsch / zu forsch (Lockerungen, laut Merkel)
free2pass (App für Tests und Einlasskontrolle)
Freiheit
Frisöre / Friseure
Fuß-Gruß
G 5 (Verschwörungstheorie um den Mobilfunkstandard)
Gästeliste (Pflicht im Lokal)
Gamma (neuer Name für brasilianische Mutante / P.1)
„Gang aufs Minenfeld“ (Erfurts OB über Lockerungen in Thüringen)
Gangelt
Gastronomie
Gates, Bill
Geisterspiele (Bundesliga etc.)
Genesene
Genesenenstatus
Geruchs- und Geschmacksverlust (als Corona-Symptom)
geschlossene Räume
geteilte Schulklassen
Google Meet (Videokonferenz-Plattform)
Grenzkontrollen
Grenzschließungen
Großeltern (nicht) besuchen
„Grüner Pass“ (Israel / bescheinigt Corona-Impfung)
Grundimmunität
Grundrechte
Grundsicherung
Gütersloh (kreisweiter Lockdown wg. Tönnies)
Händedruck (kein)
Händewaschen
Härtefall-Fonds
häusliche Gewalt
hammer and dance
Hamsterkäufe
hamstern
Heimbüro
„Heimsuchung“ (Angela Merkel am 25. Oktober 2020)
Heinsberg
Heizpilze (herbstliche Option für Gastro-Betriebe)
„Held / Heldin des Alltags“
Helmholtz-Gemeinschaft
Hepa-Filter
Herdenimmunität
Herold, Susanne (Uniklinik Gießen)
heterologe Impfung (zwei verschiedene Impfstoffe bei Erst- und Zweitimpfung)
Hildmann, Attila
Hintergrundimmunität
Hintergrundinfektion
Hirnvenenthrombosen
Hochrisikogruppe
Hochzeitsfeier
Home-Office
Home-Schooling
Hospitalisierungs-Inzidenz
Hospitalisierungsrate
Hotspot
Husten
Hust- und Nies-Etikette
Hybrid-Unterricht
„Hygiene-Demos“
Hygieneplan
Hygiene-Konzept
Hygiene-Regeln
Hygiene-Standards
Hyperglobalisierung
Ibuprofen
Imdevimab (Antikörper-Medikament)
Immunabwehr
Immun-Escape
Immunologe
Impfangebot
Impfbereitschaft
Impfbus
„Impfchaos“
Impfdosen
Impfdosis
Impfdrängler
Impfdurchbruch (Infektion trotz Impfung)
Impfgegner
Impfgipfel
Impfling
Impflücke
Impfneid
Impfpass
Impfpflicht
Impfquote
Impfreihenfolge
Impfskeptiker
Impfstau
Impfstoff
„Impfstoff-Nationalismus“
Impfstraße
Impfstrategie
Impftermin
Impfung
Impfversprechen
Impfverweigerer
Impfvordrängler
Impfwilligkeit
Impfzentrum
Impfzwang
„Impfzwang durch die Hintertür“
inaktivierte Vakzine
Infektionsampel
Infektionskette
Infektions-Notbremse
Infektionsschutzgesetz (IfSG)
„Infodemie“
Inkubationszeit
Insolvenz(en)
„Instrumentenkasten“ (verfügbare Corona-Maßnahmen)
Intensivbetten
Intensivkapazität
Intensivstation
Inzidenz
Inzidenz-Ampel
Inzidenzwert
„In (den) Zeiten von Corona“
Iota (Virus-Variante B.1526)
Ischgl
Isolation
Israel (weltweites Impf-Vorbild)
Italien
„Jens, jetzt keine Emotionen!“ (Angela Merkel zu Jens Spahn – beim Impfgipfel am 1.2.2021)
Johns-Hopkins-Universität
Johnson & Johnson (Impfstoff-Hersteller)
Kappa (Virus-Variante B.1.617.1)
Kappensitzung (Heinsberg etc.)
Kariagiannidis, Christian (Leiter Insensivbettenregister)
Kassenumhausung
Kaufprämie (für Autos)
Keimschleuder
Kekulé, Alexander S.
„…kennt keine Feiertage.“ („Das Virus kennt…“)
„…kennt keine Ferien.“ („Das Virus kennt…“)
„…kennt keine Grenzen.“ („Das Virus kennt…“)
Kita-Schließungen
„Kleeblatt-Prinzip“ (bei Verlegung von Intensiv-Patienten in andere Bundesländer)
Kliniken (im RKI-Jargon auch „Klinika“)
Knuffelcontact (Belgisch/Flämisch für den möglicherweise einzigen Kuschelkontakt)
„körpernahe Dienstleistungen“
Kontaktbeschränkung
kontaktlos
kontaktloses Bezahlen
Kontaktperson
Kontaktsperre
Kontaktsport(arten)
Kontakttagebuch
kontaminierte Oberfläche
Kreuzimpfung (z. B. Erstimpfung mit AstraZeneca, Zweitimpfung mit Biontech)
„Krise als Chance“
Krisengewinn(l)er
Krisenreaktionspläne
Kulturschaffende
Kurzarbeitergeld
laborbestätigt
Lambda (Virus-Variante C.37)
Laschet, Armin
Lauterbach, Karl (Gesundheitsminister ab Dez. 2021)
Leopoldina
Letalität
„(das) letzte Weihnachten mit den Großeltern…“ (Angela Merkel)
Lieferketten
Liquiditätshilfen
Lockdown
Lockdown Light
Lockerung
„Lockerungsdrängler“ (Röttgen)
Lockerungsperspektive
Lockerungsübung
Lolli-Test
Lombardei
Long-Covid (Langzeit-Nachwirkungen)
Luca (Warn-App)
Lüftung
Lungenentzündung
„macht sich locker“ („Deutschland macht…“)
Marderhunde (mögliche Virusquelle, laut Drosten)
Maske
Maskenintegrität
Maskengutschein
Maskenmuffel
Maskenpflicht
Maskenverweigerer
Maßnahmen
„mehr als 90 Prozent“ (Imfstoff-Wirksamkeit)
Meldeverzug
Merkel, Angela
MERS
Meyer-Hermann, Michael (Helmholtz / Braunschweig)
„mit Corona“ (verstorben)
mobile Impfteams
Moderna (US-Impfstoff-Hersteller)
Molnupiravir (Corona-Medikament)
Mortalitätsrate
mRNA-1273 (Impfstoff von Moderna)
mRNA-Impfstoff
„mütend“ (Corona-Gefühlslage, Mischung aus mürbe und wütend – oder müde und wütend)
Mund-Nasen-Schutz (MNS)
Mundschutz (Plural: Mundschutze)
Mutanten
Mutation
Nachverfolgung
„Nasenbohren“ (saloppe Umschreibung für manche Schnelltests)
Nena (Corona-Verharmloserin)
neuartig(es)
„Neue Normalität“
Neuinfektionen
New York
niederschwellige Basisschutz-Maßnahmen
Nies-Etikette
No-Covid-Strategie
Normalität
Notbetreuung
Notbremse (harte N. / flexible N.)
Notstand
Novavax (Impfstoff-Hersteller)
Novemberhilfe(n)
Null-Covid-Strategie
Obergrenze für Neuinfektionen
„Öffnungsdiskussionsorgien“ (Merkel)
Öffnungsschritte
„Öffnungsrausch“ (Markus Söder)
Olympische Spiele (in Tokyo praktisch ohne Live-Zuschauer)
Omikron / Omicron (neue südafrikanische Variante, November 2021)
Omikron-Wand (Steigerung der Omikron-Welle)
on hold („angehaltenes“ Leben)
Online-Aufführung
OP-Maske
P.1 (brasilianische Virus-Mutation)
Palmer, Boris (OB Tübingen)
Pandemie
Pandemie-Müdigkeit
Pangolin (Gürteltier als möglicher Zwischenwirt)
„Paranoia-Promis“ (Hildmann, Naidoo, Wendler, Jebsen etc.)
Party
Patentfreigabe
„Patient Null“ (ursprünglicher Überträger)
Paul-Ehrlich-Institut
Paxlovid (Corona-Medikament von Pfizer)
PCR-Test
PEG (Polyethylenglykol / Inhaltsstoff von Impfmitteln)
Penninger, Josef (speziell für unsere österreichischen Freunde)
persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Pest (Referenz-Seuche)
Pflegeheime
Pflegekräfte
Pflegenotstand
physical distancing
„Piks“ (etwas infantile Bezeichnung für die Impfung)
Plateau
Pleitewelle
Pneumokokken
Pneumonie
„Pobacken zusammenkneifen“ (Appell von RKI-Chef Wieler am 12.11.2020)
Positivrate (z. B. pro 1000 Tests)
Postcorona (die Zeit „danach“)
Präsenzunterricht
Präsenzveranstaltung
Präventions-Paradox
Prepper
Preprint (vorveröffentlichte Wissenschafts-Studie)
Priesemann, Viola (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen)
Prio (neuerdings gängige Abkürzung)
priorisieren
Prioritätsgruppe
Prof.
proteinbasierte Impfstoffe
Quarantäne
„Querdenker“ (Euphemismus für Verschwörungstheoretiker)
Rachenabstrich
Ramelow, Bodo (Vorreiter der Lockerung)
Regelbetrieb
Regeneron (US-Hersteller von Antikörper-Cocktails)
Reiserückkehrer
Reisewarnung
Remdesivir
Reproduktionsrate (gern 0,7 oder niedriger)
Respiration
Restart (Bundesliga)
Rettungsschirm
Rezeptoren
Rezession
R-Faktor
R-Wert
Risikogebiet
Risikogruppe
RKI
Robert-Koch-Institut
Rückholaktion
„Ruhetage“ (Gründonnerstag & Ostersamstag 2021 / verkündet 23.3.2021 – zurückgenommen 24.3.2021)
SARS
SARS-CoV-2
Schaade, Lars (RKI-Vizepräsident)
Schichtunterricht
Schlachthöfe (Coesfeld etc.)
Schlangenmanagement
Schlauchboot-Party (Berlin, Landwehrkanal)
Schleimhautschutz
Schmidt-Chanasit, Jonas (Bernhard-Nocht-Institut, Hamburg)
Schmierinfektion
„schmutzige Impfung“ (absichtliche Infektion mit erhoffter Genesung)
„Schnauze voll“ (Hessens Ministerpräs. Bouffier im Feb. 2021: „Die Leute haben die…“)
Schnelltest
Schnutenpulli
Schulschließungen
Schutzkittel
Schutzmaske
Schutzschirm
schwedischer Sonderweg
schwere Verläufe
Seife
Seitwärtsbewegung (Minister Spahn über kaum noch sinkende Infektionszahlen)
Selbstisolation
Sentinel-Testung (Stichproben statt Massentests)
Sequenzierung
Shutdown
Sieben-Tage-Inzidenz
Sieben-Tage-R
Sinovac (chinesischer Impfstoff)
Sinusvenen-Thrombosen
Skype
social distancing
Soloselb(st)ständige
soziale Distanz
Spahn, Jens (Gesundheitsminister, auch infiziert)
Söder, Markus
Soforthilfe
Soloselbstständige
Spanische Grippe
Sperrstunde
Spike-Protein
Speicheltest (Schnelltest)
Spuckschutz
Spucktest (Schnelltest)
Sputnik V (russischer Impfstoff)
Statistik
Stay-at-home
sterile Immunität
Stiko (Ständige Impfkommission)
Stoßlüftung
Streeck, Hendrik (Virologe, Bonn)
Stürmer, Martin (Virologe, Frankfurt)
Südkorea
Superspreader
Superspreading-Ereignis
systemrelevant
„Team Vorsicht“ (Formulierung von Markus Söder)
Tegnell, Anders (Schwedischer Epidemiologe)
Telearbeit
Telefonkonferenz (Telko)
Temperaturscanner
Test
Testkapazität
Testzentren (teilweise unter Betrugsverdacht)
Theaterschließungen
Theta (Virus-Variante P.3)
Thrombose (angebliche Impffolge)
Tönnies
Toilettenpapier
Totimpfstoff
Tracing-App
Tracking-App
„Treffen Sie niemanden!“ (Österreichs Kanzler Kurz am 14.11.2020)
Triage
Tröpfcheninfektion
„trotz Corona“
Trump, Donald (Erkrankter)
Twitter (Plattform auch für Corona-Dispute)
„Tyrannei der Ungeimpften“ (Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes)
Überbrückungsgeld
Übersterblichkeit
„Unheil“ (Angela Merkel am 14. Oktober 2020)
Untersterblichkeit
Vakzine
Variant of concern
Vaxzevria (neuer Name des AstraZeneca-Impfstoffs, seit 26.3.2021)
Verdoppelungsrate
verimpft („Sie haben 2000 Dosen verimpft“)
Vektorimpfstoff
Vektorwechsel
Verschwörungserzählung
Verschwörungsmythen
Verschwörungstheoretiker (Jebsen, Hildmann, Schiffmann, Soost, Naidu u.a.)
verzeihen
Verzeihung
Videokonferenz (Viko)
vierte Welle (befürchtet für und dann eingetreten im Herbst 2021)
Virologe(n)
Virologie
Virulenz
Virus, das
Virus, der
Virusvariantengebiet
viruzid
Volksmaske
vollständig geimpft
„Vom Verbot zum Gebot“
Vorerkrankungen
vulnerabel
„Wand“ (siehe Omikron-Wand)
Watzl, Carsten (Immunologe, Leibniz-Institut, Dortmund)
Wechsel-Unterricht
„wegen Corona“
Wellenbrecher
Wellenbrecher-Lockdown
Wendler, Der (noch so’n Corona-Leugner)
Westfleisch
WHO
Wieler, Lothar H. (RKI-Präsident)
Wildtyp
„Wir bleiben zu Hause“
Wodarg, Wolfgang
Wohnzimmerkonzert
Worst-Case-Szenario
Wuhan
„Wumms“ („Mit Wumms aus der Krise“ – Finanzminister Olaf Scholz)
Zarka, Salman (Corona-Regierungsberater in Israel, genannt „Corona-Zar“)
Zero Covid (niedrigstes Ziel)
Zero-Covid-Strategie
Zeta (Virus-Variante P.2)
Zoom (Plattform für Online-Konferenzen)
Zoonose
Zweihaushalte-Regel
„Zweimal ,Happy Birthday‘ singen“ (Zeitmaß fürs Händewaschen)
zwei Meter (Abstand)
zweite Welle
Zweitgeimpfte
_____________________________
Danke für Anregungen und Ergänzungen, die mich u. a. via Facebook erreicht haben.
Bei Virologe, Immunologe etc. bitte jeweils die weiblichen Formen hinzudenken.
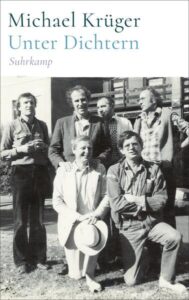 Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, 34 Euro) lässt jene Zeiten und all die Gespräche noch einmal lebendig werden. Eitelkeit nicht völlig ausgeschlossen: Jede Begegnung adelt gleichsam auch den, der davon zu berichten weiß. Es sind gesammelte Texte aus den letzten Jahrzehnten, in denen Krüger (der übrigens am 9. Dezember 82 Jahre alt wird) sich seine Gedanken u. a. über Elias Canetti, Oskar Pastor, Hermann Lenz, Jürgen Becker, Botho Strauß, Nicolas Born, Peter Handke, die erwähnten Rühmkorf und Enzensberger, Ernst Meister und Ilse Aichinger macht. Überdies gibt es auch wenige Rückgriffe in frühere Epochen (Andreas Gryphius, Eduard Mörike). Eine Fundgrube für alle literarisch Begeisterten!
Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, 34 Euro) lässt jene Zeiten und all die Gespräche noch einmal lebendig werden. Eitelkeit nicht völlig ausgeschlossen: Jede Begegnung adelt gleichsam auch den, der davon zu berichten weiß. Es sind gesammelte Texte aus den letzten Jahrzehnten, in denen Krüger (der übrigens am 9. Dezember 82 Jahre alt wird) sich seine Gedanken u. a. über Elias Canetti, Oskar Pastor, Hermann Lenz, Jürgen Becker, Botho Strauß, Nicolas Born, Peter Handke, die erwähnten Rühmkorf und Enzensberger, Ernst Meister und Ilse Aichinger macht. Überdies gibt es auch wenige Rückgriffe in frühere Epochen (Andreas Gryphius, Eduard Mörike). Eine Fundgrube für alle literarisch Begeisterten!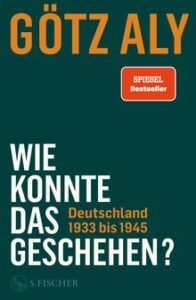 Es ist wohl eine der wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Bücherherbstes: Götz Aly „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945″ (S. Fischer, 762 Seiten, 34 Euro) stellt die immer noch und für alle Zukunft brennende Frage, warum so viele Deutsche für Hitler und die NSDAP gestimmt haben und welche höllische Mischung aus sozialen Wohltaten und polizeilicher Willkür die Gewaltherrscher damals angerichtet haben. Die eigentlich kriegsmüden Deutschen ließen sich sodann in einen erneuten Angriffskrieg und unfassbare Verbrechen hineinziehen. Götz Aly versucht, die Beweggründe und Mechanismen solchen Widersinns zu ergründen. Er geht dabei auf zahlreiche Phänomene der NS-Machtergreifung und Machtsteigerung ein. Auch Kenner der Materie werden hier auf neue Einsichten gebracht. „In dankbarer Erinnerung“ widmet Aly das Buch u. a. dem lange Zeit (1968-1996) an der Ruhr-Uni Bochum tätigen Historiker und maßgeblichen NS-Spezialisten Prof. Hans Mommsen. Ein hauptsächlicher Antrieb seines Schreibens wird in Götz Alys letztem Kapitel deutlich, er nennt es mahnend „Was geschah, kann wieder geschehen“. Wenn doch nur Bücher dieser aufrüttelnden Art den bedrohlichen Befund etwas weniger wahrscheinlich machen würden! Als der Band endlich wieder lieferbar war und ich ihn erwerben konnte, lag er immerhin schon in der dritten Auflage vor. Das wiederum wird wohl mit unguten Vorgängen in unserer Gegenwart zu tun haben. Vielen Menschen ist offenbar bewusst, dass sie sich wappnen müssen.
Es ist wohl eine der wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Bücherherbstes: Götz Aly „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945″ (S. Fischer, 762 Seiten, 34 Euro) stellt die immer noch und für alle Zukunft brennende Frage, warum so viele Deutsche für Hitler und die NSDAP gestimmt haben und welche höllische Mischung aus sozialen Wohltaten und polizeilicher Willkür die Gewaltherrscher damals angerichtet haben. Die eigentlich kriegsmüden Deutschen ließen sich sodann in einen erneuten Angriffskrieg und unfassbare Verbrechen hineinziehen. Götz Aly versucht, die Beweggründe und Mechanismen solchen Widersinns zu ergründen. Er geht dabei auf zahlreiche Phänomene der NS-Machtergreifung und Machtsteigerung ein. Auch Kenner der Materie werden hier auf neue Einsichten gebracht. „In dankbarer Erinnerung“ widmet Aly das Buch u. a. dem lange Zeit (1968-1996) an der Ruhr-Uni Bochum tätigen Historiker und maßgeblichen NS-Spezialisten Prof. Hans Mommsen. Ein hauptsächlicher Antrieb seines Schreibens wird in Götz Alys letztem Kapitel deutlich, er nennt es mahnend „Was geschah, kann wieder geschehen“. Wenn doch nur Bücher dieser aufrüttelnden Art den bedrohlichen Befund etwas weniger wahrscheinlich machen würden! Als der Band endlich wieder lieferbar war und ich ihn erwerben konnte, lag er immerhin schon in der dritten Auflage vor. Das wiederum wird wohl mit unguten Vorgängen in unserer Gegenwart zu tun haben. Vielen Menschen ist offenbar bewusst, dass sie sich wappnen müssen.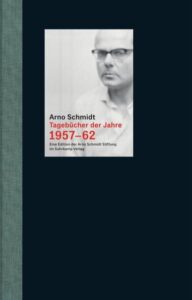 Wenn es in Nachkriegsdeutschland veritable Kult-Schriftsteller gegeben hat, so dürfte Arno Schmidt gewiss in vorderster Reihe zu nennen sein. Der Mann mit dem unvergleichlichen Schreibstil hat noch heute scharenweise eingeschworene Anhänger und willige Exegeten, die sich eingehend mit Leben, Werk und Wirkung befassen. Sie alle erhalten nun neue Nahrung, denn die Arno Schmidt Stiftung hat einen voluminösen Band mit Aufzeichnungen herausgebracht: Arno Schmidt: „Tagebücher der Jahre 1957-1962″ (Suhrkamp, 778 Seiten, 68 Euro). Schmidt führte mit seiner Frau Alice (genannt „Lilli“) seit 1958 in Bargfeld (Heidedorf in Niedersachsen) ein einsiedlerisches Leben, weit abseits von den Zumutungen allgemeiner Alltäglichkeit und doch tief in seinen eigenen Alltag vergraben, in selbstgewählte Begrenztheit. Hier erhalten wir nun Kunde bis hinein in fast schon bizarre und dennoch immer wieder aufschlussreiche Banalitäten. Beliebiges Beispiel aus dem März 1958: „Ich blättre. Lilli bügelt.“ Kurz darauf: „Ich wurmisiere. Lilli Aufräumen + Abwaschen / Kaffeerausch; und über mehreres nachgedacht (…) Lilli badet (…) / Noch lesen: {ich Herder} Lilli Kreuzworträtsel!“ Derlei Mitteilungen Zeile für Zeile und Zug um Zug über Hunderte von Seiten zu lesen, ist schon eine arge Herausforderung, zumal man den Mann keineswegs sympathisch finden muss. Man lese nur die teilweise hundsgemeinen Äußerungen über seine dienstbare Frau, deren Unterordnung ihm allerdings kaum je genügt… Register, Fotos, Fußnoten, Faksimiles und zeitliche Einordnungen erschließen dies und jenes, es handelt sich um eine (von Susanne Fischer herausgegebene) sorgfältige, ja geradezu liebevolle Edition; ganz so, wie es einem Arno Schmidt zukommen könnte. Was ER dazu wohl gesagt hätte? Wahrscheinlich hätte er haltlos geschimpft, wie beinahe über alles. Übrigens hatte, später ebenfalls von Susanne Fischer ediert, Alice Schmidt zuvor Tagebuch geführt und dies recht abrupt aufgegeben. Es gibt heutige Leser, die ihre Aufzeichnungen seinen Auslassungen bei weitem vorziehen.
Wenn es in Nachkriegsdeutschland veritable Kult-Schriftsteller gegeben hat, so dürfte Arno Schmidt gewiss in vorderster Reihe zu nennen sein. Der Mann mit dem unvergleichlichen Schreibstil hat noch heute scharenweise eingeschworene Anhänger und willige Exegeten, die sich eingehend mit Leben, Werk und Wirkung befassen. Sie alle erhalten nun neue Nahrung, denn die Arno Schmidt Stiftung hat einen voluminösen Band mit Aufzeichnungen herausgebracht: Arno Schmidt: „Tagebücher der Jahre 1957-1962″ (Suhrkamp, 778 Seiten, 68 Euro). Schmidt führte mit seiner Frau Alice (genannt „Lilli“) seit 1958 in Bargfeld (Heidedorf in Niedersachsen) ein einsiedlerisches Leben, weit abseits von den Zumutungen allgemeiner Alltäglichkeit und doch tief in seinen eigenen Alltag vergraben, in selbstgewählte Begrenztheit. Hier erhalten wir nun Kunde bis hinein in fast schon bizarre und dennoch immer wieder aufschlussreiche Banalitäten. Beliebiges Beispiel aus dem März 1958: „Ich blättre. Lilli bügelt.“ Kurz darauf: „Ich wurmisiere. Lilli Aufräumen + Abwaschen / Kaffeerausch; und über mehreres nachgedacht (…) Lilli badet (…) / Noch lesen: {ich Herder} Lilli Kreuzworträtsel!“ Derlei Mitteilungen Zeile für Zeile und Zug um Zug über Hunderte von Seiten zu lesen, ist schon eine arge Herausforderung, zumal man den Mann keineswegs sympathisch finden muss. Man lese nur die teilweise hundsgemeinen Äußerungen über seine dienstbare Frau, deren Unterordnung ihm allerdings kaum je genügt… Register, Fotos, Fußnoten, Faksimiles und zeitliche Einordnungen erschließen dies und jenes, es handelt sich um eine (von Susanne Fischer herausgegebene) sorgfältige, ja geradezu liebevolle Edition; ganz so, wie es einem Arno Schmidt zukommen könnte. Was ER dazu wohl gesagt hätte? Wahrscheinlich hätte er haltlos geschimpft, wie beinahe über alles. Übrigens hatte, später ebenfalls von Susanne Fischer ediert, Alice Schmidt zuvor Tagebuch geführt und dies recht abrupt aufgegeben. Es gibt heutige Leser, die ihre Aufzeichnungen seinen Auslassungen bei weitem vorziehen.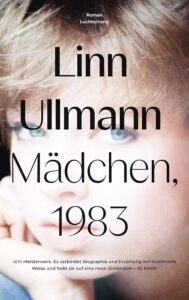 Der Romantitel könnte vor allem Frauen ansprechen, die zu jener Zeit ihre Pubertätsjahre erlebt und durchlitten haben: Linn Ullmann „Mädchen, 1983″ (Luchterhand, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt von einer damals 16-Jährigen, die einem Modefotografen erlauben wollte, in Paris Fotosessions mit ihr zu machen – gegen den Willen der Mutter, was ihren Freiheitsdrang jedoch erst recht befeuert hat. Nun, beinahe 40 Jahre später, will sie sich Rechenschaft über ihr Leben als junges Mädchen und die Zeit seither ablegen. Kann sie den Menschen verstehen, der sie seinerzeit gewesen ist? Der norwegischen Schriftstellerin Linn Ullmann wurde in einigen Rezensionen bescheinigt, sie gehöre in die Tradition der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Immer diese Vergleiche! Jedenfalls weitet sich der Roman zu einer generellen, streckenweise furiosen Reflexion über Irrungen und Wirrungen eines exemplarischen (Frauen)-Lebens. Dabei beginnt der allererste Satz doch so unscheinbar und schlicht: „Ich bin sechzehn Jahre alt…“
Der Romantitel könnte vor allem Frauen ansprechen, die zu jener Zeit ihre Pubertätsjahre erlebt und durchlitten haben: Linn Ullmann „Mädchen, 1983″ (Luchterhand, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt von einer damals 16-Jährigen, die einem Modefotografen erlauben wollte, in Paris Fotosessions mit ihr zu machen – gegen den Willen der Mutter, was ihren Freiheitsdrang jedoch erst recht befeuert hat. Nun, beinahe 40 Jahre später, will sie sich Rechenschaft über ihr Leben als junges Mädchen und die Zeit seither ablegen. Kann sie den Menschen verstehen, der sie seinerzeit gewesen ist? Der norwegischen Schriftstellerin Linn Ullmann wurde in einigen Rezensionen bescheinigt, sie gehöre in die Tradition der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Immer diese Vergleiche! Jedenfalls weitet sich der Roman zu einer generellen, streckenweise furiosen Reflexion über Irrungen und Wirrungen eines exemplarischen (Frauen)-Lebens. Dabei beginnt der allererste Satz doch so unscheinbar und schlicht: „Ich bin sechzehn Jahre alt…“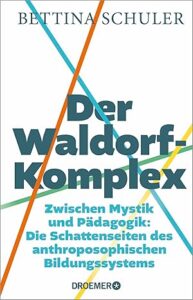 Ehemalige Waldorf-Schülerin übt grundsätzliche Kritik an der Waldorf-Pädagogik. Mit dieser knappen Feststellung und mit dem länglichen Untertitel des Buchs ist die Stoßrichtung umrissen. Bettina Schuler: „Der Waldorf-Komplex. Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems“ (Droemer Paperback, 218 Seiten, 20 Euro) hält mit den Absichten nicht hinter dem Berg. Die dem Plakativen nicht vollends abgeneigte Autorin (vorheriger Erfolgstitel: „Schlachtfeld Elternabend“) geht zurück auf die weltanschaulichen Herleitungen der anthroposophischen Pädagogik und findet dabei wissenschaftsferne und autoritäre Elemente zuhauf. Obwohl sich Bettina Schuler nicht ungern an die eigene Schulzeit erinnert, benennt sie doch typische Waldorf-Lehrinhalte, die schlimmstenfalls sogar die Demokratie gefährden könnten. Sie setzt daher ihre Hoffnungen auf einen kreativen Sinneswandel in den öffentlichen Schulen, denn Waldorf-Pädagogik sei kaum veränderbar, sofern sie auf Rudolf Steiners Ideen beharre. Und wenn sie diese Basis verlasse, sei es eben keine wirkliche Waldorf-Pädagogik mehr.
Ehemalige Waldorf-Schülerin übt grundsätzliche Kritik an der Waldorf-Pädagogik. Mit dieser knappen Feststellung und mit dem länglichen Untertitel des Buchs ist die Stoßrichtung umrissen. Bettina Schuler: „Der Waldorf-Komplex. Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems“ (Droemer Paperback, 218 Seiten, 20 Euro) hält mit den Absichten nicht hinter dem Berg. Die dem Plakativen nicht vollends abgeneigte Autorin (vorheriger Erfolgstitel: „Schlachtfeld Elternabend“) geht zurück auf die weltanschaulichen Herleitungen der anthroposophischen Pädagogik und findet dabei wissenschaftsferne und autoritäre Elemente zuhauf. Obwohl sich Bettina Schuler nicht ungern an die eigene Schulzeit erinnert, benennt sie doch typische Waldorf-Lehrinhalte, die schlimmstenfalls sogar die Demokratie gefährden könnten. Sie setzt daher ihre Hoffnungen auf einen kreativen Sinneswandel in den öffentlichen Schulen, denn Waldorf-Pädagogik sei kaum veränderbar, sofern sie auf Rudolf Steiners Ideen beharre. Und wenn sie diese Basis verlasse, sei es eben keine wirkliche Waldorf-Pädagogik mehr.