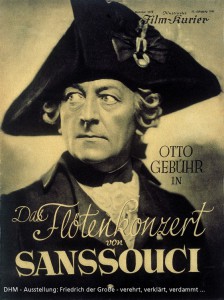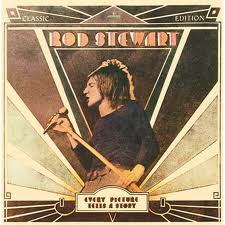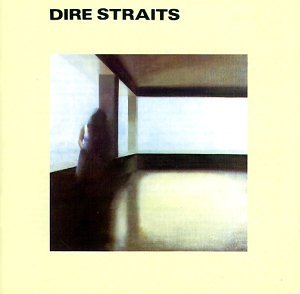Nostalgischer Charme: Friedrich von Flotow zum 200. Geburtstag
Ach so fromm, ach so traut – aber wer hat sie in letzter Zeit geschaut? Friedrich von Flotows „Martha“ ist wohl vor allem älteren Operngängern ein Begriff. Auch zum 200. Geburtstag ihres Schöpfers, eines Sprosses aus mecklenburgischem Uradel, bleibt die heiter-harmlos wirkende Spieloper den Bühnen fern. Und das, obwohl mit der zitierten Arie viele Tenöre Schmelz und Schwärmen demonstriert haben – vom Duisburger Rudolf Schock bis zum Modeneser Luciano Pavarotti. Aber „Martha, Martha“ ist entschwunden, und mit ihr – nein, nicht das Portemonnaie, wie eine Parodie beklagt, sondern die knapp vierzig anderen Opern, Operetten, Singspiele und Ballette, die Kammermusik- und Salonstücke des Herrn von Flotow.
Ja, Groß Flotow gibt es wirklich, in Mecklenburg, mit 184 Einwohnern und einem schlicht gehaltenen Gutshaus, wie die offizielle Website des Amtes Penzliner Land mitteilt. Der Komponist jedoch erblickte am 27. April 1812 in Teutendorf, heute Ortsteil von Sanitz, einen möglicherweise grauen mecklenburgischen Himmel. Sein Leben dagegen verlief heiterer als manch andere Komponistenlaufbahn. Friedrich hatte einen offenbar verständnisvollen Vater, denn der reiste mit dem fünfzehnjährigen Knaben nach Paris, damit er dort in den Händen von Anton Reicha zum Musiker heranreife. Für einen preußischen Offizier dieser Zeit zweifellos ein Akt der Selbstüberwindung, seinen Sohn den brotlosen Tonkünsten statt der angesehenen Diplomatie zu überlassen.
Mit zwanzig Jahren wirft sich Flotow in den „Betrieb“ der musikalischen Hauptstadt Europas. Er vertont heitere Petitessen, schreibt ein Couplet hier, ein Salonstück da, versucht sich an kleinen Öperchen à la Daniel François Esprit Auber, dem damaligen Abgott der Opéra-comique. Das erste wird in der Heimat aufgeführt, in Ludwigslust: „Pierre et Catherine“. Offenbar gefiel sein Stil, der den amüsierwilligen Zuhörer nicht mit teutonisch grübelnder Schwere niederdrücken wollte. Auch die Eleganz und der Erfindungsreichtum seiner Melodien werden stets gelobt. Wie es auch immer um das nach historisch-kritischen Kriterien noch nicht erforschte Wirken Flotows stand: 1839 gelingt ihm mit „Le Naufrage de la Meduse“ ein beachteter Erfolg. Das Stück wird immerhin 54 Mal in einem Jahr gezeigt. Es ebnet ihm offenbar den Weg auf die Bühne der Opéra-comique: 1843 kommt dort „L’esclave de Carmoëns“ heraus, später auf Deutsch am Wiener Kärntnertortheater als „Indra, das Schlangenmädchen“ aufgeführt.
Flotow lernt in Paris einen anderen jungen Deutschen kennen: Jakob Offenbach, genannt Jacques, abgebrochener Cello-Studiosus. Der spätere Maître der unterhaltungsverrückten Pariser Gesellschaft lässt damals noch nicht die Grisetten tanzen, sondern lebt von „Muggen“, also gelegentlichen, schlecht bezahlten und dem Renommée kaum einträglichen Auftritten. Mit Flotow durchzieht er hinfort die Salons und assistiert dem betuchten Adligen beim Erstellen von Arrangements. Sie mögen sich, der Kölner und der Mecklenburger. Dreißig Jahre später experimentieren beide mit der Operette. Offenbach mit Riesenerfolg, Flotow so na ja: Seine „Veuve Grapin“ (1859) war offenbar nicht das, was man heute einen „Brüller“ nennen würde. Wie dieses Stückchen wirklich klingt, kann man demnächst erfahren, denn es gibt nicht nur seit einem Jahr beim Label Line Music eine Rundfunkaufnahme von 1951 auf CD, sondern in der „Hauptstadtoper“ in Berlin ab 4. Mai eine Serie von Aufführungen. Bei anderen Werken sucht man jedoch vergeblich nach Noten, Aufnahmen oder gar Aufführungen, nicht einmal „ad experimentum“.
In den 1840er Jahren weist die Kurve von Flotows Karriere steil nach oben. Jetzt arbeitet er für die großen musikalischen Institutionen in Paris, die „Opéra“ und die „Opéra-comique“. Er lernt den Dichter Friedrich Wilhelm Riese kennen, ein Landsmann aus Berlin, der Flotows wichtigster Librettist werden sollte. Gemeinsam landen sie 1844 in Hamburg mit „Alessandro Stradella“ einen Coup. Fortan gehört Flotows Name in die Spielpläne der Theater; er zählt in dieser Zeit neben Heinrich Marschner und Albert Lortzing zu den wichtigen Komponisten deutscher Herkunft. Und dann „Martha“: 1847 in Wien uraufgeführt, schlägt das heiter-sentimentale Gesellschaftsmärchen mit ironischer Unterströmung alle Rekorde.
Jetzt ist Friedrich von Flotow am Gipfel des Ruhmes angelangt. Die Hymne auf das Porterbier, die schmachtende Tenorarie „Ach so fromm“, das rührende irische Volkslied von der „Letzten Rose“: Flotow verwebt treffsichere „Hits“ in ein Werk, das dem Adel kein gutes Zeugnis ausstellt und Lady Harriett als ein ziemlich abgefeimtes Stück auftreten lässt, das sich herzlich wenig um die Befindlichkeit seiner Spielfiguren kümmert. Flotow musste diese Schicht wohl gekannt haben; wer weiß, welche Eindrücke von den Schlössern des mecklenburgischen Landadels in seine „Martha“ eingeflossen sind.
Vicco von Bülow hat in Flotow offenbar einen Geistesverwandten erkannt: Mit unnachahmlich feinem Humor, preußisch verkühlter Koketterie und sicherem, aber liebevollem Blick für die Schwächen und Bosheiten der Bühnenfiguren hat er „Martha“ nicht nur mit Hunden – will heißen: Möpsen –, sondern auch mit Charme und jener naiv anmutenden Heiterkeit auf die Bühne gebracht, die nur der wissende Geist so unbeschwert gegenwärtig zu setzen weiß. Seit der Premiere 1986 in Stuttgart ist diese Inszenierung über diverse Bühnen gewandert und war zuletzt am Münchner Gärtnerplatztheater zu sehen: Zu hoffen ist, dass sie nach der Renovierung des Hauses nicht dem historisch uninformierten Entrümpelungswahn eines Intendanten – wer auch immer es dann auch sein sollte – zum Opfer fällt.
Wie gesagt: Flotows einstiger Erfolg ist selten geworden. Der Zeitgeist ist solchen Werken nicht günstig gesinnt. Das hat gute Gründe: Die Probleme der Ständegesellschaft sind uns heute ebenso fremd wie die Beziehungsfragen eines patriarchalistischen Zeitalters; der zensurgeeignete, bis zum Schmerz verharmloste Humor ebenso wie die jede Provokation meidende Kompositionsweise. Nach Wagner und Verdi ist eben vieles vorherhörbar geworden, und was das Ohr des Pariser oder Wiener Komödienbesuchers damals als angenehm empfunden hat, ruft heute nicht einmal mehr homöopathische Abgaben von Endorphinen oder gar Adrenalin hervor.
Doch deswegen ist Flotow weder zu verachten noch zu verdrängen. Denn was damals als „pikant“ galt – die Sittenwächter waren durchaus argwöhnisch! –, kann heute im Sinne einer „zweiten Ebene“ durchaus theaterwirksam und im besten Sinne unterhaltend wirken. Zu denken ist an Nostalgie und Ironie: Ich erinnere mich an eine Coburger „Martha“ von 2006, die vom goldenen Licht einer wehmütigen Erinnerung überglänzt war, ein Märchen aus einer vergangenen Zeit, inszeniert als Bild einer Kindheitsfantasie, der man sich erinnerungsselig hingeben kann.
Wie man aus den zum Genre gehörenden Klischees Funken schlägt, indem man sie mit den Stereotypen von heute konfrontiert, hat der Regisseur Roman Hovenbitzer in einer derzeit laufenden Inszenierung von „Alessandro Stradella“ in Gießen vorgeführt. Dieser erste Erfolg Flotows ist seit Jahren nicht mehr in Deutschland gegeben worden. Die letzte Inszenierung der Werks um den skandalträchtigen Lebenswandel des Barockkomponisten Alessandro Stradella gab es 2001 beim irischen Wexford Opera Festival. Dort spann sich eine mäßig einfallsreiche Regie um die zentrale Melodie der Oper, die Hymne „Jungfrau Maria“, einst ebenfalls ein Zugstück für Tenöre.
In Gießen hat Regisseur Roman Hovenbitzer nun die Bezeichnung „Romantisch“ hinterfragt und sich lieber auf die musikalische Machart verlassen, die unverkennbar die Mittel der französischen „Opéra comique“ anwendet. Schon immer im Wege stand dem Werk die undramatische Handlung. In drei Akten wird eine Variante des Komödientopos bedient, der da lautet: Alter Vormund will junges Mündel heiraten; die schwärmt in diesem Fall den bewunderten Sänger Stradella. Zwei Auftragskiller sollen den Barden aus dem Wege räumen. Doch sind sie zwei Akte lang am finalen Schuss gehindert, weil die wunderschöne Stimme selbst die finsteren Seelen der Mordgesellen rührt. Ende gut, alles gut: Stradella bekommt das Mädel und die Musik hat wieder einmal ihre Macht bewiesen.
Hätten sich Hovenbitzer und sein Bühnenbildner Hermann Feuchter auf eine flott gespielte, knackig bebilderte Komödie beschränkt, wäre das langatmig und nett gewesen, mehr aber auch nicht. Doch jenseits der Lachimpulse, wie ein Karton mit der Aufschrift „Vorsicht Kunst“ mit der kessen Leonore als Inhalt, vertiefen sie die knallbunte Szene immer intensiver mit emblematischen Zeichen. Dann wird aus der Geschichte zum Beispiel die eines pubertierenden Mädchens, das seinen Star anhimmelt.
Doch Hovenbitzer/Feuchter graben tiefer. Sie führen mit leichter Hand zentrale Motive der Künstler-Mythologie ein, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden sind und wie sie – zum Starkult degeneriert – noch heute wirken: mediale Vermittlung, zweckgerichtete Ansprache von Emotionen und Klischees, den Künstler als „Heiland“ im Kreis seiner Jünger. Die Madonna steht für die Fixierung auf das Ideal der „Reinheit“ der Frau im 19. Jahrhundert, aber auch für die ideologische Überhöhung des unerreichbaren Weiblichen im Gegensatz zum realen Objekt sexueller Begierde.
Die beiden komischen Killer schießen den Star dann doch über den Haufen, weil die gebotene Kohle mehr lockt als der Reiz des Gesangs. Damit bricht Hovenbitzer das Happy End, führt die Oper dann aber doch zum glücklichen Ende – allerdings als ironische Reminiszenz an die trivialromantische Vorstellung von der Macht der Musik und der Liebe. „Alessandro Stradella“ in Gießen wird so zu einer klug konzipierten Revue über Mentalitäten und geistige Konzepte, auf denen Flotows Oper basiert, ohne sie ausdrücklich anzusprechen. Aus biederem Unterhaltungstheater für den mundtot gemachten Bürgerstand nach 1848 wird ein witziges Lehrstück über Oper, Kunst und Geist im 19.Jahrhundert – nicht im Sinne eines musealen Vorzeigens, sondern als Befragung auf relevante Inhalte.
Friedrich von Flotows Leben verlief nach seinen beiden „Treffern“ unstet: Er schrieb für Berlin und Wien, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg, nahm 1855 die Stelle des Hofmusikintendanten in Schwerin an, ging zurück nach Paris und zog sich 1873 auf sein Mecklenburger Stammgut Teutendorf zurück. Ob er sich 1870 mit „L’Ombre“ an der Opéra-comique nicht durchsetzen konnte, weil seine Musik nicht goutiert wurde oder der Deutsch-Französische Krieg ausbrach – wer will es wissen? Seine letzte Oper erschien 1876 in Turin auf der Bühne; zwei Werke blieben unvollendet, als Flotow 1883 in Darmstadt einem Schlaganfall erlag.
In den letzten Jahren gab es hin und wieder „Martha“ – sogar an Theatern wie der Wiener Volksoper. In Schwerin, wo Flotow acht Jahre wirkte, inszenierte Robert Lehmeier 2009 den Klassiker. Die Produktion wird aus Anlass von Flotows Geburtstag wieder aufgenommen, aber nur zwei Mal gespielt – zum letzten Mal am 17. Mai. Die Oper Halle bringt „Martha“ am 12. Mai im Goethe-Theater in Bad Lauchstädt heraus.
In Schwerin, Hauptstadt Mecklenburgs und Sitz eines Staatstheaters, hat der 200. Geburtstag Friedrich von Flotows immerhin zu einem Kammerkonzert und zu einer Ausstellung im Parkettfoyer des wunderschönen Theaterbaus geführt: „„Mein siebenjähriger Krieg – Flotow in Schwerin“ heißt ihr Titel. Zu mehr konnte man sich nicht verständigen: Kein Werk Flotows in den Sinfoniekonzerten, keine Neuinszenierung einer Oper; offenbar auch nirgends wenigstens eine wissenschaftliche Konferenz. Man darf spekulieren, dass die Ketten des Etats das Theater an jedem Flugversuch in diese Richtung abhalten. So kann selbst ein Staatstheater eine seiner genuinen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Das sei den Kulturpolitikern hierzulande gesagt: Ein materiell verarmtes Theater holt auch bald die geistige Armut ein.