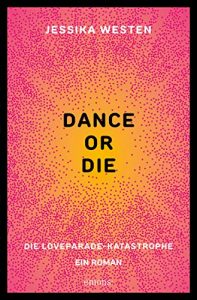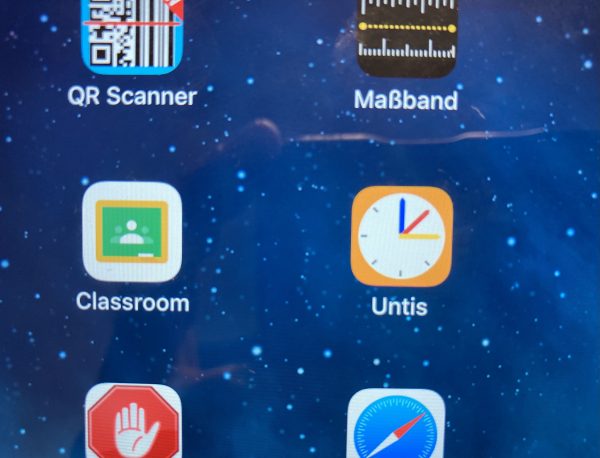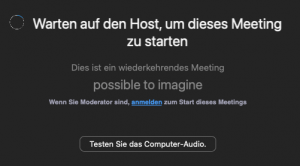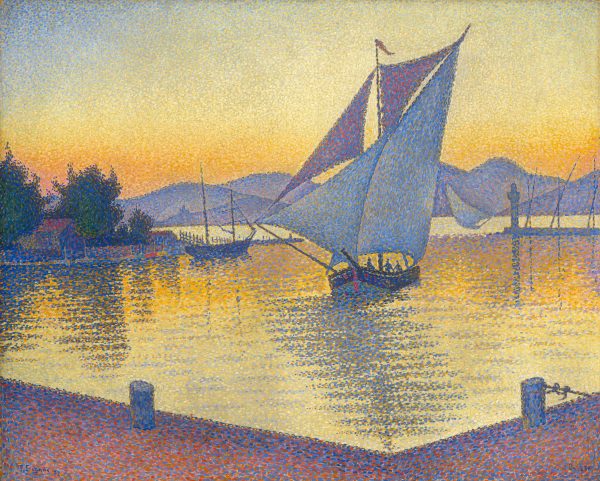Auch am Theater Hagen erzwang die Corona-Pandemie eine umfassende Revision der Pläne zunächst für die erste Hälfte der Saison 2020/21.

Eine Ikone des 20. Jahrhunderts greift ein Opern-Doppelabend am Theater Hagen auf: Marilyn Monroe. (Foto: Klaus Lefebvre)
Die Spielzeit-Vorschau, ein hübsches rotes Kästchen, enthält für jedes Projekt aus den Sparten ein loses Blatt, das ausgetauscht werden kann, wenn Intendant Francis Hüsers und sein Team infolge der Corona-Schutzmaßnahmen umplanen müssen. Für die Zeit bis Dezember war das bereits der Fall: Die Schlachtschiffe des Repertoires stehen im Trockendock bereit, zu einem späteren Zeitpunkt gefahrlos auszulaufen. Der Ersatz, klein, kurz und flexibel, macht aber ebenfalls Freude. Krisen fördern zuweilen Kreativität: Wie wäre es sonst zu einem Doppelabend mit Joseph Haydns „L’Isola disabitata“ und Gavin Bryars 2013 uraufgeführter Kammeroper „Marilyn forever“ gekommen?
In beiden etwas mehr als einstündigen Werken geht es um Einsamkeit, um einen Prozess der Selbstfindung und um die Frage, wie authentisch ein Mensch sein Leben eigentlich führen kann. In Haydns „unbewohnter Insel“ sind es zwei Frauen, die sich einen Weg über ihre inneren Limits hinaus bahnen müssen; „Marilyn forever“ wirft die Zuschauer mitten hinein in die Spannung zwischen den inneren Empfindungen und der äußeren Selbstkonstruktion eines Menschen.

Was steckt hinter den Bildern, mit denen die Monroe berühmt wurde? Angela Davis versucht sich, in die Figur „Marilyn“ hineinzufühlen. (Foto: Klaus Lefebvre)
An der Kultfigur Marilyn Monroe, die sie sich als Waisenkind Norma Jeane Mortenson geschaffen hat, versucht Gavin Bryars Einakter zu ergründen, wo der Mensch, wo der Mythos „Marilyn Monroe“ zu entdecken ist, wie sich das Innen und Außen dieser Ikone des 20. Jahrhunderts zueinander verhalten: Die Frau, als warmherzig und selbstbewusst beschrieben, mit ihrer sorgfältig nach außen abgeschirmten Seele, verletzlich, liebesbedürftig, an sich zweifelnd. Die Fassade, glamourös, sexy, mit kalkulierter Ausstrahlung. Und die Wirkung, in Zeiten patriarchaler Herren, rebellierender Söhne, marginalisierter und missbrauchter Frauen, reduziert auf das Objekt: begehrt, vermarktet, konsumiert, vergöttert und gleichzeitig abgewertet.
Kantenlose Musik
Regisseur Holger Potocki versucht sich in etwa 80 Minuten durch dieses verschlungene Dickicht vorzukämpfen zur „echten“ Marilyn Monroe – etwas, was sie selbst wohl nicht geschafft hat. Das Libretto Marilyn Bowerings ist ihm dabei keine Hilfe: Zu ungefähr sind die Gefühlszustände, Gedanken, Träume von „Marilyn“, zu vage die Bezüge zu historisch feststellbaren Ereignissen, etwa die Ehe mit Arthur Miller, zu spekulativ die Andeutungen, etwa über das Verhältnis zu John F. Kennedy.
Kaum Unterstützung auch aus der Musik: Denn der inzwischen 77jährige englische Komponist Gavin Bryars schrieb 2013 eine nachromantisch kantenlose Musik mit Elementen aus minimal music und Jazz, mit verfliegenden Scheinzitaten populärer Musik der Fünfziger, weich, schmeichelnd, mit der dunklen Registerpalette der Instrumente und moderater Dynamik spielend. Alles „well made“, angenehm zu hören, aber nicht charakteristisch, schon gar nicht irgendetwas provozierend. Und neu im Übrigen auch nicht – aber das muss ja nicht unbedingt sein. Joseph Trafton und die elf Musiker des Philharmonischen Orchesters Hagen lassen den schmiegsamen Wohllaut fein abgestimmt verströmen.

Angela Davis als Marilyn. Foto: Klaus Lefebvre
Potocki bleibt also in den Rätseln hängen, und er weiß das: Um dem Wohlfühlfluss der Szenen zu entkommen, teilt er gemeinsam mit Bernhard Niechotz die Bühne in zwei Räume und spaltet die Figur der Marilyn auf: Angela Davis gibt nicht die Ikone Monroe, sondern versucht als – zeitweise sehr intensive – Darstellerin sich in einem Studio für einen Film auf die Rolle „Marilyn Monroe“ vorzubereiten und dafür die Facetten der Figur zu verinnerlichen. In der anderen Hälfte der Bühne, einem Kinosaal, setzt sich Kenneth Mattice als Filmregisseur mit Bildern und Vorstellungen der Monroe auseinander. Er fällt in die Rollen der „Men“ aus dem Leben Monroes, grübelt zwischen Kinostühlen, experimentiert mit Bildern auf der Leinwand. Potocki nutzt die distanzierende Wirkung von Film, Projektion und Spiegeln, um die Entfremdung der Personen von sich selbst auf die Spitze zu treiben, sich dem Geheimnis der authentischen Existenz der Titelfigur anzunähern und es gleichzeitig zu wahren.
Das reicht bis zu den unklaren Umständen ihres frühen Todes: Kenneth Mattice, der sich selbst spielerisch vorbehaltlos verausgabt, dringt in den „Raum“ Marilyns ein und ist – kurz bevor das Licht erlischt – der Funke des Todes für die zitternde Frau. Dass danach das berühmte blaue Kleid und eine weißblonde Perücke auf dem Bühnenboden liegen wie aufgebahrt, ist konsequent: Den äußeren Schein können wir begraben, den Mythos entschlüsseln wir nur bruchstückhaft, die Wahrheit bleibt verborgen. Welchen Anspruch Bryars allzu unverbindliche Oper verwirklicht, darüber mag die Nachwelt entscheiden. Kritiker lagen allzu oft daneben – dennoch sei es gewagt, sich nicht wie die Oper ins Ungefähre zurückzuziehen: Die Nachwelt wird eher den Mythos Monroe als dieses Werk am Leben halten.
Eine Burg aus Polstern
Nicht am Leben blieb auch Joseph Haydns „L’Isola disabitata“, einer seiner gar nicht so wenigen, aber leider kaum bekannten Opern. Uraufgeführt 1779 auf Schloss Eszterháza (heute Fertöd in Ungarn), konnte sie sich trotz mehrerer CD-Aufnahmen nicht im Repertoire durchsetzen. Das Libretto Pietro Metastasios – er schätzt es selbst sehr hoch ein – wirkt in der Inszenierung Magdalena Fuchsbergers geradezu modern: Die „unbewohnte Insel“ wird zu einem Ort von Introversion und Aufbruch, von Selbstverkapselung und Selbstentfaltung.

Maria Markina als Costanza in Joseph Haydns „L’Isola disabitata“ in Hagen. Foto: Klaus Lefebvre
Fuchsberger transferiert das Thema der verlassenen Frau auf dem menschenleeren Eiland in die siebziger Jahre, als die Frauen um Gleichberechtigung kämpfen und der Sex sich aus den Fesseln der überkommenen Moral befreit. Wieder ist die Bühne zweigeteilt: In Monika Bieglers Wohnlandschaft steht links ein graues Sofa, Zuflucht der Frau mit dem bezeichnenden Namen Costanza: Unermüdlich die Männer hassend wartet sie auf den ihren, der seit 13 Jahren verschollen ist. Die einsame Standhafte baut dort eine Burg aus Polstern aus, in deren Gruft sie sich verkriecht.
Auf der anderen Seite Esstisch und Vitrine, Ort der tastenden, misslingenden Versuche, so etwas wie Gemeinschaft oder gar Zuneigung herzustellen. Maria Markinas Gesten und Bewegungen sprechen von ihrem Leid, ihren inneren Zwängen, ihrer Selbstisolierung, ihrem Lebensüberdruss; musikalisch gelingen ihr die Momente der Innerlichkeit besser als die schmerzvolle Empörung in Rezitativen, die mit hartem Ton und druckvoller Emission aus ihr herausbrechen. Ob dieser Frau am Ende gelingt, frei zu werden, als der Mann nach Jahren endlich aus der Sklaverei fliehen und zu ihr zurückkehren kann, bleibt offen: Die Regie dreht die Rollen um, als Gernando, der Mann, auftaucht, als sei nichts geschehen, und die Frau, Costanza, die Chiffren der Entfremdung übernimmt. Der Wein zu viert am Tisch lässt immerhin eine Hoffnung offen.
Ein Kind wird erwachsen
Erstaunlich modern und spannend wirkt, wie sie die jüngere Schwester Costanzas im Lauf des Stücks entwickelt. Haydn hat – zumindest in der Lesart Fuchsbergers – eine überraschend tiefgründige Coming-of-Age-Geschichte in faszinierend sensible Musik gefasst. Silvia, der Name des Mädchens, deutet auf die ungebrochene Natürlichkeit ihres Wesens hin. „Welch‘ glückliche Unschuld“, findet auch Costanza, und Metastasio beschreibt Silvias Liebe zu einem kleinen Reh – eine bezaubernde Chiffre für das kindlich-ungebrochene Einssein mit der Natur, während die Musik Haydns bereits die Trauer über den Verlust dieses „paradiesischen“ Zustands erklingen lässt.

„Glückliche Unschuld“: Silvia (Penny Sofroniadou) mit ihrem geliebten Reh. (Foto: Klaus Lefebvre)
Mit der Ankunft von Gernando und dessen Freund Enrico beginnt der Prozess: Silvia nimmt den Mozart’schen Cherubino vorweg, wenn sie nach der ersten Begegnung mit dem freundlich-virilen Enrico (Insu Hwang mit markantem Bariton) von einem unbekannten „affetto“ in der Brust singt, einer Hoffnung, von der sie nicht weiß, was sie bedeutet. Ihre Schwärmerei hat auch komische Züge, verdichtet sich aber immer mehr zur Erkenntnis der „tyrannischen“ Liebe, die ihr keine Ruhe mehr lässt. Und während Anton Kuzenok die melancholische Suche Gernandos nach seiner geliebten Costanza in einen fein geführten, die Töne frei bildenden Tenor kleidet, erzählt die Musik, wie Silvia das „heftige Feuer“ der Liebe und damit ihr sexuelles Begehren entdeckt, und Penny Sofroniadou schildert ihre Not zum sprechenden Orchester Haydns mit einem leuchtenden, leichten und lockeren Sopran. Aus der engagierten kleinen Truppe im Graben lockt Joseph Trafton alle Herrlichkeiten von Haydns Erfindungskunst hervor und bestätigt ein weiteres Mal, dass man den Esterházy’schen Kapellmeister nicht unterschätzen sollte.
Bisher geplante weitere Aufführungen am 13. und 14. November 2020. Info: https://www.theaterhagen.de/veranstaltung/die-einsame-insel-lisola-disabitata-marilyn-forever-1339/0/show/Play/