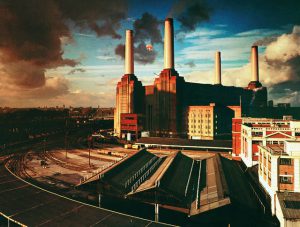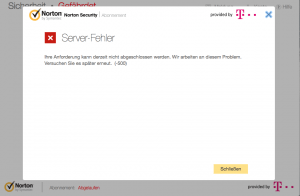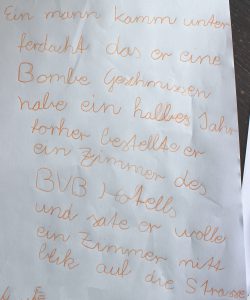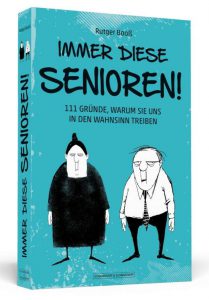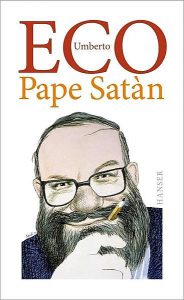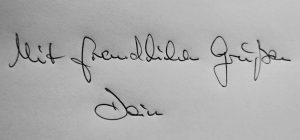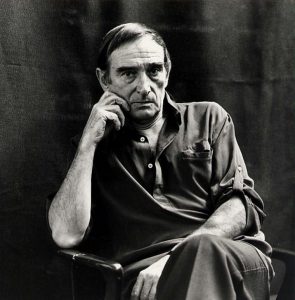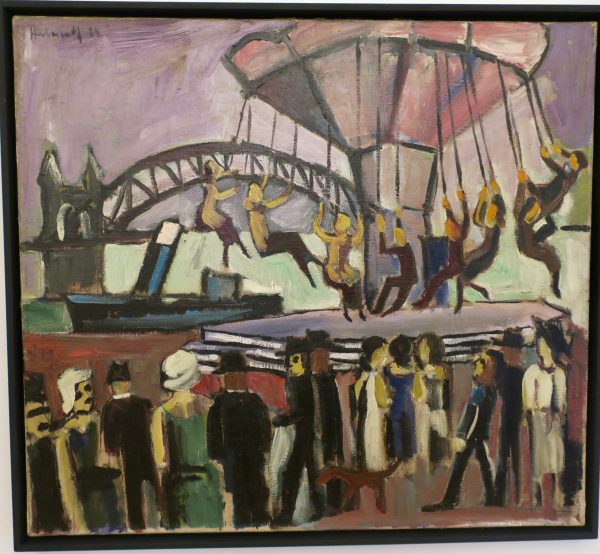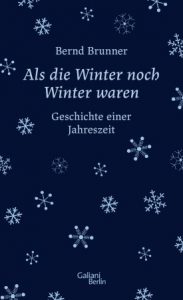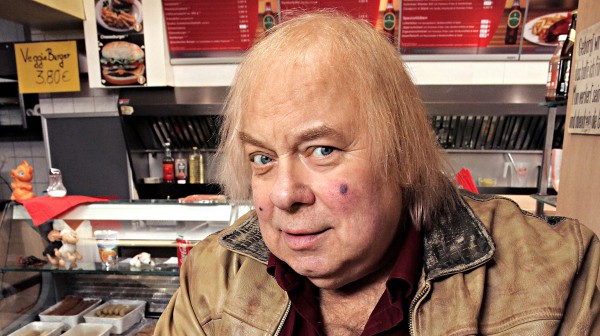Zunächst einmal dies, das Allerwichtigste: Man kann nur sehr erleichtert sein, dass Marcel H. (19), der mutmaßliche Kindesmörder von Herne, gestern Abend festgenommen worden ist.
Er selbst hat dem Inhaber einer griechischen Imbissstube in Herne gesagt, er sei der seit drei Tagen Gesuchte und hat von dort aus selbst die Polizei angerufen.

Kann man ein solches Thema abstrakt bebildern? Ja, das ist für ein Kulturblog vielleicht sogar das Beste. (Foto: BB)
Im Ruhrgebiet war und ist es d a s Thema dieser Tage. Wohin man auch kommt, so gut wie überall wird darüber gesprochen. Als Vater kann ich – natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grade – nachfühlen, was Eltern, Verwandte und Freunde des erstochenen neunjährigen Jungen durchmachen.
Trotz allem die Rechtstreue wahren
Ja, man kann sogar nachempfinden, dass nicht alle Regungen, die sich nun mehr oder weniger offen Luft verschaffen, den rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen. Doch gerade, wenn man sich etwa über antidemokratische Tendenzen in anderen Ländern empört, muss man auch in einem solchen Falle strikt rechtstreu vorgehen. Die Tat muss möglichst zweifelsfrei und gerichtsfest bewiesen werden. Erst dann kann die Strafe folgen.
Mit der Verhaftung sind längst nicht alle Fragen beantwortet. Die Polizei wird noch einige Zeit weiter ermitteln müssen. Nach dem jetzigen Stand gibt es zwei Opfer und Marcel H. wäre ein Doppelmörder.
Pressekonferenz mit neuen Erkenntnissen
Um 16 Uhr hat es heute eine Pressekonferenz in Dortmund gegeben, die auf mehreren Info-Kanälen live übertragen wurde und auf der verstörende Details bekannt wurden. Mehrere Ermittler sprachen von „Neuland“, das sie in ihrem bisherigen Berufsleben noch nicht betreten hätten.
Demnach hat Marcel H. inzwischen den Mord an dem 9-jährigen Jungen gestanden und auch zugegeben, einen 22-jährigen flüchtigen Bekannten in dessen Herner Wohnung erstochen zu haben. Dann hat er laut Geständnis dort Feuer gelegt, um Spuren zu verwischen. Bei seiner Vernehmung soll Marcel H. „eiskalt und emotionslos“ gewirkt haben, so Klaus-Peter Lipphaus, Leiter der zuständigen Bochumer Mordkommission.
Äußerst wirr und vergleichsweise läppisch klingen die vermeintlichen Beweggründe für die blutrünstigen Taten, die jeweils mit Dutzenden von Messerstichen ausgeführt wurden. Zum einen habe es eine Absage der Bundeswehr gegeben, hinzu kam offenbar der Umzug in eine Nachbarstadt, wo der computerspielsüchtige Marcel H. angeblich keinen Internetzugang gehabt hätte. Wie es hieß, wollte er sich deswegen zunächst das Leben nehmen, doch mehrere Suizid-Versuche seien misslungen…
Während der gesamten Pressekonferenz war übrigens abgekürzt von „Marcel H.“ die Rede. Warum ich das so betone, wird sich gleich zeigen.
Eine gierige Klick-Maschine
Ursprünglich ging es mir eigentlich um etwas anderes, nämlich um das abermals fragwürdige Verhalten mancher Medien in den letzten Tagen.
Gewiss, auch andere haben stellenweise zweifelhaft berichtet, doch habe ich ein Angebot etwas genauer beobachtet, weil das Medium eben mitten im Revier sitzt und somit besonders nah am Geschehen war: Ich meine den Online-Ableger der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ / Funke-Gruppe), www.derwesten.de
Dieser Auftritt hat kürzlich ein neues Erscheinungsbild erhalten, auch sind Konzept und Stoßrichtung geändert worden. Es handelt sich, wie ich finde, seither zu großen Teilen nicht mehr um eine herkömmliches journalistische Offerte mit (selbst)kritischer Balance. Sondern? Um eine gellend boulevardeske, unentwegt nach Aufmerksamkeit gierende Klick-Maschine, die furchtbar gern jüngere (Werbe)-Kunden ansprechen möchte und die User daher munter duzt. Das kann einem schon unter normalen Umständen gehörig auf die Nerven gehen.
Infos auch für notorische Gaffer
Im Falle Marcel H. hat derwesten.de freilich mehrfach den Bogen überspannt. Sehr früh schon, nämlich bereits in den Morgenstunden am vergangenen Dienstag, hat man den vollen Namen des dringend Verdächtigen (der sich angeblich im Internet mit der Tat gebrüstet hatte) genannt. Hier geht es keineswegs um Mitleid mit dem mutmaßlichen Mörder, sondern um sein familiäres und sonstiges Umfeld. Besonders in Herne selbst gibt es wahrscheinlich viele, die mit dem Namen etwas anfangen können, etwaige Spinner und Idioten eingeschlossen.
Auch mögliche Gaffer und vielleicht auch Trittbrettfahrer wurden sozusagen bestens bedient. Man las in den vielfach aufgeregt-kurzatmigen Berichtsfetzen nicht nur den Straßennamen des Tatorts, sondern konnte auf Fotos auch Hausnummern erkennen und hätte sich vermutlich einiges erschließen können, um ungebeten „vor Ort“ aufzutauchen.
Dass es durchaus anders geht, belegt die gedruckte WAZ. Dort wird noch auf der heutigen Titelseite der Name des mutmaßlichen Täters abgekürzt – was der Berichterstattung übrigens keinerlei Abbruch tut und nichts von ihrer Brisanz nimmt.
Das Fahndungsfoto hätte genügt
Das von der Polizei herausgegebene Fahndungsfoto hätte vollauf genügt. Schließlich hatten die Beamten dringend davor gewarnt, den eventuell bewaffneten Kampfsportler Marcel H. anzusprechen oder gar auf eigene Faust stellen zu wollen. Sofort die Polizei anrufen, so lautete die richtige Anweisung. Wozu also der vollständige Name? Polemisch gefragt: Sollte man sich etwa als Passant seinen Ausweis zeigen lassen?
Bemerkenswert, dass derwesten.de am Dienstagnachmittag vorübergehend zurückruderte und den Namen wieder zu Marcel H. abkürzte; sei’s, dass ein mahnender Hinweis aus der Rechtsabteilung gekommen war, sei’s, dass jemand mit Weisungsbefugnis in der Redaktion ein Einsehen hatte.
Doch ach, die Zurückhaltung währte nicht lange. Kaum war klar, dass inzwischen auch andere Medien gleichfalls mit dem kompletten Namen herausrückten, stieg auch derwesten eilends wieder damit ein. Die Dämme waren nun einmal gebrochen. Geradezu genüsslich hieß es nun auch wieder, der mutmaßliche Täter werde „gejagt“.
Kläglich hilflose Wortwahl
Als er schließlich gefasst war, lautete die kläglich hilflose Formulierung, die Polizei habe ihn „geschnappt“. Leute, wir sind hier nicht bei einem harmlosen Spielchen wie „Spitz, pass auf!“ – „Geschnappt“, das kann man vielleicht mal bei einem x-beliebigen Taschendieb sagen, aber doch nicht bei einem mutmaßlichen Kindermörder. Da gibt es einige passendere Worte.
Der im Grunde schrecklich banale Vorgang, dass Marcel H. sich in einer Imbissbude gestellt hat, wird in einem Anreißer so aufbereitet, um nicht zu sagen „hochgehottet“: „So abgebrüht und dreist stellte … (voller Name) sich den Behörden„. Die dürren Mitteilungen, die dann folgen, rechtfertigen die vollmundige Ankündigung nicht.
Auch nach der besagten Pressekonferenz tönte man bei derwesten.de lauthals weiter. Zitat: „Eiskalt, aber er stach 120 Mal zu…“ Was das eingeschobene „Aber“ genau zu bedeuten hat, erschließt sich nicht. Und welch‘ eine Meisterleistung: die Stiche beider Mordtaten zu addieren und als summarische Horrorzahl zu präsentieren.
So sehr und mit allen technischen Mitteln (Texte, Fotos, Filme etc.) warf sich derwesten auf die Berichterstattung, so rundum wurde alles „gecovert“, dass man punktuell schon von Panikmache sprechen konnte. Der Informationsauftrag wurde gleichsam übererfüllt. Spürbar war die Konkurrenz mit der „Bild“-Zeitung, von der man sich im Kern des Ruhrgebiets keinesfalls übertrumpfen lassen wollte (und die – wen wundert’s? – auch ohne sonderliche Skrupel berichtete).
Nicht alles auf die Goldwaage, aber…
Übrigens, nur zum Beispiel: Auch der öffentlich-rechtliche WDR 2-Hörfunk hat nicht durchweg mit Maß und Ziel berichtet. Heute ließ man ohne Not und ohne jegliche Relativierung eine Hernerin im O-Ton zu Wort kommen, die ihr Kind seit Tagen nicht zur Schule geschickt und sich selbst in der Wohnung verbarrikadiert hatte. Und dann gleich wieder Musik…
Zurück zu derwesten.de: Ja klar, ich habe gut reden. In der allgemeinen Hektik kann man wohl nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Allerdings: Gedruckt stünde es für alle Zeiten da, online könnte man noch ein paar Kleinigkeiten korrigieren. Vor allem aber wäre es gut, wenn man merken würde, dass die Redaktion einen halbwegs verlässlichen Kompass hat.
Man kann allerdings neuerdings öfter den Eindruck bekommen, dass derwesten.de drauf und dran ist, den (auch nicht stets über jeden Zweifel erhabenen) journalistischen Ruf der WAZ in Mitleidenschaft zu ziehen.