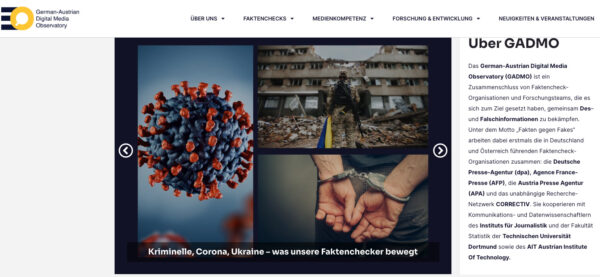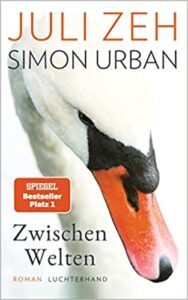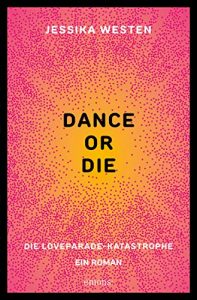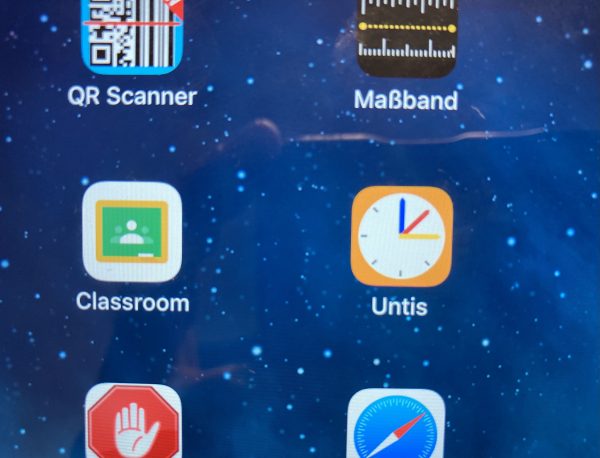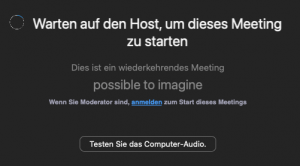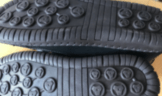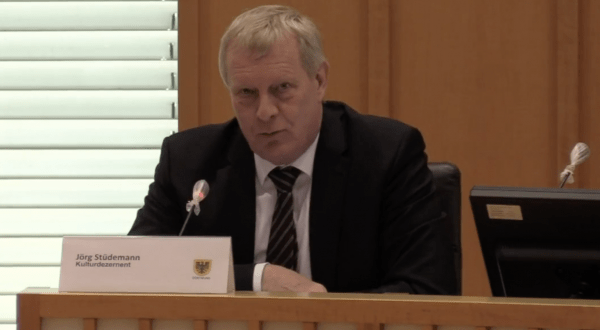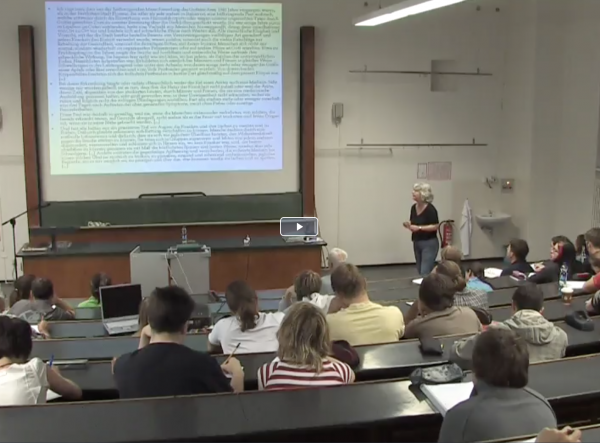Das waren noch andere Zeiten: Blick in den Zuschauerraum des Dortmunder Opernhauses – vor Beginn einer Vorstellung. (Foto: Bernd Berke)
Hier mal wieder ein paar Nachrichten aus dem derzeit stark eingeschränkten (Dortmunder) Kulturleben, kompakt zusammengestellt auf Basis von Pressemitteilungen der jeweiligen Einrichtungen.
Die Mitteilungen werden – im unteren Teil dieses Beitrags – von Tag zu Tag gelegentlich ergänzt und/oder aktualisiert, auch gibt es dort Neuigkeiten aus anderen Revierstädten, vor allem über weitere Absagen, aber auch zu Online-Aktivitäten.
Theater Dortmund: Keine Vorstellungen bis 28. Juni
Das Theater Dortmund bietet auf seinen sämtliche Bühnen (Oper, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater) bis einschließlich 28. Juni 2020 keine Vorstellungen an. Wie es danach weitergehen wird, weiß noch niemand.
Die Regelung schließt die Konzerte der Dortmunder Philharmoniker im Konzerthaus Dortmund ein. Der Betrieb im Theater läuft jedoch bis zur Sommerpause weiter. Neue mobile Vorstellungsformate sollen ab Mai 2020 bis zum Ende der Spielzeit 2019/20 aufgenommen werden.
Dazu Tobias Ehinger, der Geschäftsführende Direktor des Theater Dortmund: „So sehr wir diesen Schritt bedauern, steht die Gesundheit unseres Publikums sowie unserer Kolleginnen und Kollegen im Mittelpunkt. Jedoch dürfen wir auch in der jetzigen Zeit, unser Leben nicht nur auf Funktionalität begrenzen. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die hohe Bedeutung von Kultur. Kultur ist nicht hübsches Beiwerk oder Luxus, sondern elementar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir fordern die Entscheidungsträger in Bund und Land auf, Maßnahmen und Konzepte zur schrittweisen Öffnung unserer Theater und Konzertsäle zu beschließen und die Gesellschaft nicht durch ein zu kurz gegriffenes Verständnis der Systemrelevanz zu trennen.“
___________________________________________________
Unterdessen werden Spielpläne für die nächste Saison online per Video-Präsentation angekündigt:
Philharmoniker, Oper und Ballet
So wird sich – wie die Theater-Pressestelle mitteilt – in der Spielzeit 2020/21 bei den Konzerten der Dortmunder Philharmoniker alles um das Verhältnis zwischen Mann und Frau drehen.
Das Motto der Spielzeit lautet „Im Rausch der Gefühle“. Ergänzend heißt es, die berühmtesten Paare der Weltliteratur, wie Romeo und Julia, Othello und Desdemona, Orpheus und Eurydike sowie Tristan und Isolde, hätten die Komponisten zu großartigen Orchesterwerken inspiriert.
Da die weitere Entwicklung der Corona-Krise noch nicht prognostizierbar sei, könne es ggf. noch zu „Anpassungen“ kommen.
Textversion des Spielplans unter: www.tdo.li/tdo2021
Generalmusikdirektor Gabriel Feltz erläutert den Spielplan 2020/21, hier ist der Link, der auch zur Präsentation des Opern-Spielplans (durch Opernchef Heribert Germeshausen) und des Balletts (durch Ballettchef Xin Peng Wang) führt: https://www.theaterdo.de/medien/videos/spielzeit-2021/
Kinder- und Jugendtheater
Das Kinder- und Jugendtheater (KJT) Dortmund startet mit neun Neuproduktionen und neun Wiederaufnahmen in die neue Spielzeit 2020/21. Als Motto hat sich KJT-Direktor Andreas Gruhn mit seinem Team den „Freien Fall“ gesetzt. In einer Welt, in der politische Systeme ins Wanken geraten und die Natur zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät, scheint sich die Abwärtsspirale immer schneller zu drehen. Aus dem Unglück des Fallens können aber auch ungeahnte Möglichkeiten wachsen.
Auch beim KJT heißt es: „Da die weitere Entwicklung der Corona-Krise noch nicht prognostizierbar ist, kann es ggf. zu Anpassungen kommen.“
Printversion des Spielplans unter www.tdo.li/tdo2021
Video mit Andreas Gruhn unter www.theaterdo.de/publikationen/videos
_________________________________________
Auch das Konzerthaus Dortmund präsentiert das Programm der nächsten Saison auf digitalem Weg:
In einem Video erläutert Intendant Raphael von Hoensbroech, welche hörenswerten Künstler und Konzerte ab September in der Spielzeit 2020/21 zu erwarten sind. Hoensbroech lädt daher zu einem virtuellen kleinen Ausflug ins Konzerthaus.
______________________________________________
Dortmunds neues Literaturstipendium um drei Monate verschoben:
Dortmunds erste „Stadtbeschreiberin“, Judith Kuckart, wird aufgrund der Corona-Krise erst ab August 2020 für sechs Monate nach Dortmund kommen. Ursprünglich hatte sie ihr Stipendium im Mai antreten wollen. Ihre für den 15. Mai geplante Auftaktlesung im Literaturhaus soll trotzdem stattfinden – allerdings ohne Live-Publikum: Das Literaturhaus am Neuen Graben zeigt die Lesung aus dem aktuellen Roman „Kein Sturm, nur Wetter“ online am 15. Mai 2020 ab 19.30 Uhr (weitere Infos unter www.literaturhaus-dortmund.de).
Neues Konzertformat „Musik auf Rädern“
Am Dienstag, 5. Mai 2020, startet das Theater Dortmund das der Corona-Pandemie angepasste Konzertformat „Musik auf Rädern“. An verschiedenen Standorten in Dortmund werden die Oper Dortmund und die Dortmunder Philharmoniker jeweils um 16 Uhr kleine Live-Konzerte von ca. 20 Minuten Dauer geben. Die Abstandsregelungen werden dabei eingehalten. Mit dem Programm kommt das Theater Dortmund vor allem zu den Menschen, die aufgrund ihrer Identifizierung als „Risikogruppe“ besonders in ihrem Bewegungsfreiraum eingeschränkt sind. Der erste Auftritt findet mit der Sopranistin Irina Simmes vor dem Seniorenwohnsitz „Kreuzviertel“ 44139 Dortmund-Kreuzviertel, Kreuzstraße 68 / Ecke Lindemannstraße statt.
_________________________________________
Eröffnungsfest im Naturmuseum fällt aus
Die für den 7. Juni geplante große Wiedereröffnung des Naturmuseums nach Jahren des Umbaus fällt aus. Die neue Dauerausstellung soll voraussichtlich im September eröffnen.
„Robin Hood“-Schau bis 20. September
Das derzeit noch geschlossene Museum für Kunst und Kulturgeschichte an der Hansastraße verlängert seine ursprünglich bis Mitte April geplante Familienausstellung „Robin Hood“ bis zum 20. September.
„Studio 54″ vorerst nicht in Dortmund
Das „Dortmunder U“ kann die ab 14. August geplante Ausstellung „Studio 54″ (Übernahme aus dem Brooklyn Museum) über den legendären New Yorker Nachtclub in diesem Jahr nicht mehr zeigen.
Diesmal kein Micro!Festival
Das Micro!Festival, das sonst immer am letzten Wochenende der Sommerferien stattfand, fällt in diesem Jahr komplett aus.
_________________________________________
Blicke in die anderen Städte des Ruhrgebiets:
2020 keine Ruhrtriennale
Die Ruhrtriennale wird 2020 nicht stattfinden. Der Aufsichtsrat der Kultur Ruhr GmbH hat diesen Beschluss einstimmig gefasst. Das Festival hätte vom 14. August bis zum 20. September stattfinden sollen. Rund 700 Künstlerinnen und Künstler aus 40 Ländern wären an den 33 Produktionen und Projekten beteiligt gewesen. Sowohl die Intendantin Stefanie Carp als auch Ko-Intendant Christoph Marthaler haben Unverständnis über diese Entscheidung geäußert.
ExtraSchicht fällt ebenfalls aus
Auch die ExtraSchicht muss wegen Corona ausfallen. Die Nacht der Industriekultur hätte am 27. Juni zum 20. Mal die Metropole Ruhr bespielen sollen.
Die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) hatte bis zum letzten Moment an Alternativkonzepten gearbeitet. Die Durchführung einer Veranstaltung Ende Juni mit über 250.000 Besuchern sei aber derzeit nicht verantwortbar, so die RTG. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr sei wegen des großen organisatorischen Aufwandes nicht möglich. Das Geld für bereits erworbene Tickets wird zurückerstattet. Mehr Infos unter www.extraschicht.de.
„Mord am Hellweg“ auf Herbst 2021 verschoben
Die zehnte Ausgabe des Krimi-Festivals „Mord am Hellweg“ (Zentrale in Unna) wird um ein Jahr verschoben. Die für diesen Herbst geplante Jubiläumsausgabe wird auf die Zeit vom 18. September bis 13. November 2021 verlegt. Weitere Infos unter www.mordamhellweg.de
Moers Festival diesmal rein digital
Auch das renommierte Moers Festival (29. Mai bis 1. Juni) geht diesmal als digitales Festival über die Bühne. Die Konzerte werden als Livestream auf der Website, bei Facebook und bei Arte concert gezeigt. WDR 3 wird wie gewohnt übertragen.
Infos: www.moers-festival.de
Wittener Tage für Neue Kammermusik nur im Radio
Die Wittener Tage für Neue Kammermusik (24. bis 26. April 2020) haben sich ebenfalls umgestellt: In diesem Jahr kamen die Konzerte ausschließlich übers Radio. WDR 3 richtete das Festival als exklusives Hörfunk-Ereignis aus.
Infos unter www.wdr3.de und www.kulturforum-witten.de
Klangkunst in Marl als virtuelle Führung
Das Skulpturenmuseum Glaskasten Marl zeigt seine Klangkunst-Ausstellung diesmal per Video: „sound + space“ von Johannes S. Sistermanns und Pierre-Laurent Cassère ist online zu sehen. Im Mittelpunkt der virtuellen Führung steht ein Gespräch des Museumsdirektors Georg Elben mit dem Klangkünstler Sistermanns. Das Video ist auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de und demnächst mit weiteren Informationen auch unter www.skulpturenmuseum-glaskasten-marl.de zu sehen.
Impulse Theater-Festival fällt aus
Das Theater-Festival „Impulse“, das vom 4. bis 14. Juni hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden – besonders schmerzlich, weil zum 30-jährigen Bestehen des Festivals einige besondere Programme geplant waren. Bestimmte Teile sollen als digitale Formate im ursprünglich geplanten Festival-Zeitraum online gezeigt werden. Details dazu demnächst unter: www.impulsefestival.de
Theater Oberhausen: „Die Pest“ als Miniserie im Netz
Das Oberhausener Theater zeigt eine Bühnenbearbeitung nach Albert Camus‘ Roman „Die Pest“ als Miniserie in fünf Episoden. Gezeigt wird die Serie im Internet ab Samstag, 2. Mai, dann weiter wöchentlich, jeweils ab 19.30 Uhr. Weitere Infos: www.die-pest.de
3Sat zeigt Bochumer „Hamlet“ – jetzt via Mediathek
Im Rahmen seiner Reihe „Starke Stücke“ zeigt der TV-Sender 3Sat am Samstag, 2. Mai., um 20.15 Uhr eine Aufzeichnung von Johan Simons‘ Bochumer „Hamlet“-Inszenierung. Bis zum 30. Juli 2020 bleibt die Inszenierung in der Mediathek von 3Sat greifbar.

Auch hierhin würden Theaterfans im Revier gern wieder pilgern: Schauspielhaus Bochum. (Foto: Bernd Berke)