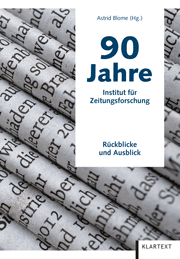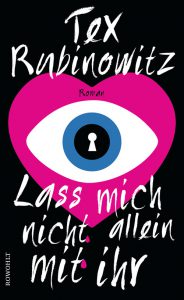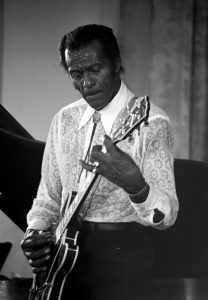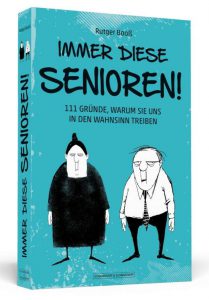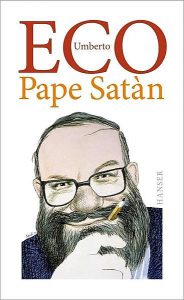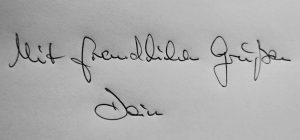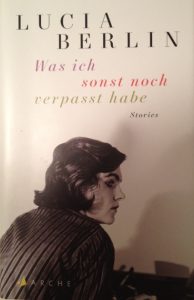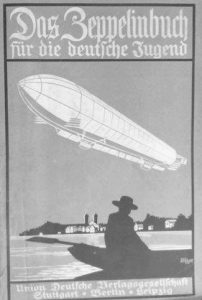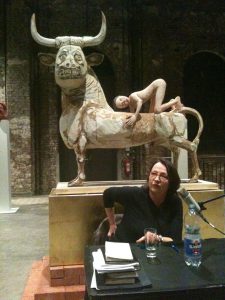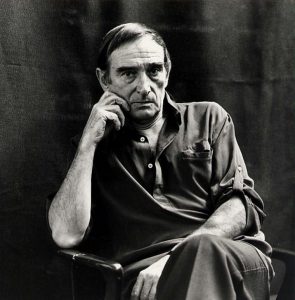„Essen außer Haus“ damals und heute – drei Dortmunder Museen tischen ein populäres Thema auf
Essen außer Haus – na und? Das machen wir doch alle ziemlich oft. Eben! Und früher war das noch ganz anders. Also haben wir hier ein populäres Alltagsthema im historischen Wandel. Folglich ist es museumsreif. Drei Dortmunder Häuser haben sich zusammengetan, um je eigene Aspekte darzustellen: das Hoesch-Museum, das Brauereimuseum und das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK). Das zeitliche Spektrum der lokalen und regionalen Schlaglichter reicht ungefähr von 1880 bis in die Gegenwart.
Den Anfang macht jetzt das Hoesch-Museum. Der spätere Dortmunder Stahlriese Hoesch hatte 1871 mit gerade einmal 300 Arbeitern begonnen, zu Spitzenzeiten um 1966 beschäftigte man an drei Standorten in der Stadt fast 50.000 Arbeitskräfte. Heute sind es unter dem Konzerndach von ThyssenKrupp nur noch 1400. Doch hier und jetzt geht es weniger um den radikalen Strukturwandel, sondern um die Frage, wie so viele Menschen sich in den Fabriken ernährt haben. Es war ja die grundlegend veränderte Arbeitswelt mit ihren strikten Zeittakten, die das (nicht selten hastige) „Essen außer Haus“ mit sich brachte.
Schlichte Suppen aus dem „Henkelmann“
Museumsleiter Michael Dückershoff weiß beim Rundgang durch die kleine Ausstellung Spannendes zu berichten. Anfangs brachten die Hoesch-Arbeiter meist ihren Henkelmann mit, das waren (oft emaillierte) Blechbehälter, in denen sie meist sehr einfache Suppen transportierten. Selbst Butterbrot war damals noch zu teuer, von Fleischgerichten ganz zu schweigen. Häufig brachten auch Frauen und Kinder der Arbeiter die Henkelmänner zum Stahlwerk. Außerdem wurden so genannte Wärmewagen bereitgestellt, auf denen die Nahrung in nummerierten Fächern warm gehalten und zu den Produktionsstätten gefahren wurde.
Zur Jahrhundertwende, im Januar 1900, eröffnete die so genannte Werksschänke (zunächst unter dem Namen „Werksschenke“), in der massenhaft Mahlzeiten aus der Großküche kamen. Auch dies ein Zeichen des Wandels: In den frühen Jahren gab es täglich ein einziges Gericht, in den 1960er Jahren standen vier verschiedene zur Auswahl, darunter auch die Option „salzlose Diät“.
Bierverkauf gegen Schnapskonsum
Heute würde man solche Saalbetriebe „Kantinen“ nennen, damals bezeichnete dieser Begriff jene vielen Kioske, die sich übers Werksareal verteilten und bei denen man Essen, Tabakwaren und irgendwann auch Bier der Marke Kronen kaufen konnte. Zu früheren Zeiten waren die Werksdirektoren froh, wenn wenigstens nur Bier statt Schnaps getrunken wurde. Später wurden die Regeln – wie überall – ungleich strenger.
Zweifellos mussten in einem Stahlwerk („Heißbetrieb“) jede Menge Getränke her. Also fuhren auch Lieferwagen mit „Hüttentee“ (süßer Pfefferminzgeschmack) übers Gelände, zudem wurde etwa seit den 1930er Jahren Milch angeboten.
Ein edler Weinkeller für die Chefs
Für sich selbst richteten die Chefetagen 1920 einen recht edlen Weinkeller bei Hoesch ein, in dem rund 200 Sorten lagerten, darunter feinste Tröpfchen. Hier wurden denn auch wichtige Gäste bewirtet. Überdies galt der Weinkeller als „abhörsicher“, worauf die Bosse (wohl vor allem wegen Industriespionage) großen Wert legten.
Die klassenlose Gesellschaft wurde bei Hoesch nicht erfunden. Für lange Zeit hatten die Angestellten einen eigenen Speisesaal – getrennt von den Arbeitern.
Freilich konnten alle Beschäftigten in einem Großbetrieb wie Hoesch die Notzeiten nach den Weltkriegen etwas besser überstehen. Solche Unternehmen kauften zeitweise sogar eigene Bauernhöfe, um ihre Belegschaft zu versorgen. Auch so erklärt sich die außerordentliche Anhänglichkeit, mit der Arbeiter dem Werk lebenslang treu blieben.
Und jetzt? Ein paar Fotos lassen es ahnen: Die verbliebenen Mitarbeiter versorgen sich vielfach in den umliegenden Imbiss-Betrieben rings um den Borsigplatz mit Döner, Currywurst und Artverwandtem. Nichts Besonderes mehr.
Stimmen von Zeitzeugen sind gefragt
All dies wird erst in Erzählungen halbwegs lebendig, die Exponate auf der überschaubaren Ausstellungsfläche des Hoesch-Museums geben von allein nicht ganz so viel her. Texttafeln und historische Fotografien werden mit relativ wenigen Schaustücken ergänzt, die das Ganze mit etwas Aura anreichern.
Gut also, dass zur Schau auch ein 15minütiger Film gehört, in dem Zeitzeugen nähere Auskunft geben. Sehr willkommen wäre es den Machern, wenn sich weitere Leute meldeten, die aus eigener Anschauung von damals berichten können. Wie man sich denken kann, wird es höchste Zeit, solche Stimmen zu sammeln. Eine öffentliche Kostprobe wird es am 6. April (18:30 Uhr) im Hoesch-Museum geben, wenn sich ältere Augenzeugen zu einer Podiumsrunde versammeln.
Die Ära der prachtvollsten Restaurants
Wann, wenn nicht dann? Genau am Tag des deutschen Bieres (23. April) werden das Brauereimuseum und das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, ebenfalls mit zwei kleineren Ausstellungen, in den Reigen einsteigen. Im Brauereimuseum wird die regionale Geschichte der Speisegaststätten in den Blick genommen. Museumsleiter Heinrich Tappe erläutert, dass das Essen im Restaurant gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Paris aufgekommen ist und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in deutschen Großstädten üblich wurde – zuerst nicht für die breiten Massen, sondern für ein bürgerliches Publikum.
Die Leute mussten überhaupt erst lernen, was es hieß, „draußen“ zu essen und wie man sich dabei zu benehmen hatte. In seiner Ausstellung will Tappe u. a. zeigen, dass bereits in den Jahren zwischen 1890 und 1914 die prächtigsten Gaststätten entstanden sind, die später nie mehr übertroffen wurden. Weitere Leitlinie: Von den 1920er bis in die 1950er Jahre wird das Essen außer Haus (auch in Ausflugslokalen) immer selbstverständlicher, bis in den 1960ern mit Cevapcici, Pizza und mehr allmählich die Internationalisierung des Speisenangebots einsetzt.
Besucher dürfen eigene Objekte mitbringen
Im Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) wird man sich mit einer Studioschau begnügen. Die Fläche wird gastweise bespielt vom Deutschen Kochbuchmuseum, das seinen angestammten Ort im Westfalenpark aufgegeben hat und seither – durch missliche Umstände bedingt (statisch gefährdeter „Löwenhof“, in den man nun doch nicht einziehen kann) – immer noch nach einer dauerhaften Bleibe sucht; möglichst unter demselben Dach wie die Volkshochschule, die den „Löwenhof“ verlassen muss.

Es ist angerichtet: das Ausstellungsteam (von links: Michael Dückershoff vom Hoesch-Museum, Jens Stöcker vom MKK, Heinrich Tappe von Brauereimuseum und Isolde Parussel vom Kochbuchmuseum) an einem historischen Herd. (Foto: Katrin Pinetzki / Stadt Dortmund)
Im MKK kann Isolde Parussel, Leiterin des Kochbuchmuseums, also demnächst an die Existenz ihres derzeit heimatlosen Instituts erinnern. Hier soll die Perspektive noch einmal geweitet werden. Neben Kantinenessen und Schulspeisungen geht es dabei auch um neuere Entwicklungen wie Lieferdienste. Der Ansatz reicht über die bloße Präsentation von Exponaten hinaus: Im Rahmen der Ausstellung können und sollen Besucher(innen) von eigenen Erfahrungen berichten und passende Fotos oder Objekte einbringen.
Kooperation als Modellfall
MKK-Direktor Jens Stöcker deutete an, dass die jetzige Kooperation dreier Dortmunder Museen ein Modellfall sein könnte. Wenn es sich anbietet, kann man auch andere Themen gemeinsam anpacken. Von Fall zu Fall und je nach Sachlage könnten dabei auch das (seit Langem im Umbau befindliche) Naturkundemuseum oder das Westfälische Schulmuseum einbezogen werden.
So weit, so durchaus interessant. Wenn man denn Kritik an der dreifachen Schau „Essen außer Haus“ üben wollte, so allenfalls deshalb, weil man sich das Ganze größer angelegt wünschen würde. Mit mehr Vorbereitungszeit und mehr Ressourcen hätte man aus dem Thema wohl noch weitaus mehr herausholen können, es wäre noch schmackhafter geworden. Bundesweite Aufmerksamkeit wäre einem solchen Unterfangen gewiss gewesen. Schade. Aber es kann halt nicht immer ein Fünf-Gänge-Menü sein.
„Essen außer Haus. Vom Henkelmann zum Drehspieß.“ In diesen drei Dortmunder Museen:
Hoesch-Museum (Eberhardstraße 12) vom 2. April bis 9. Juli. https://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/hoesch_museum/start_hoesch/index.html
Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Hansastraße 3) 23. April bis 1. Oktober. www.mkk.dortmund.de
Brauerei-Museum (Steigerstraße 16) 23. April bis 31. Dezember 2017. www.brauereimuseum.dortmund.de