Dieser Autor bemüht sich emsig um Zeitgeist-Sprech. Jan Küveler (Jahrgang 1979), seines Zeichens Feuilletonist und Theaterkritiker der „Welt“, beliebt über Shakespeare und dessen Zeit so zu extemporieren: „Draußen auf den Weltmeeren wurde die Globalisierung erfunden, das ´Globe Theatre‘ war ihr Social-Media-Hub.“ Ahoi!
Doch wir wollen nicht schon gleich zu Beginn polemisch werden und nur noch schnell erwähnen, dass Jan Küveler laut Klappentext mit einer Arbeit über jugendliche Romanhelden promovierte, die sich der Reife verweigern.
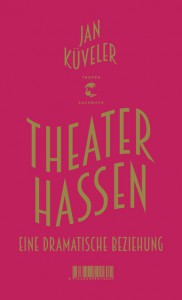 Küveler also umkreist in seinem Buch mit dem finster entschlossenen Titel „Theater hassen“ den nach seiner Ansicht vielfach beklagenswerten Zustand der Bühnenkunst; ein Thema also, über das sich im Prinzip schon die antiken Griechen echauffiert haben.
Küveler also umkreist in seinem Buch mit dem finster entschlossenen Titel „Theater hassen“ den nach seiner Ansicht vielfach beklagenswerten Zustand der Bühnenkunst; ein Thema also, über das sich im Prinzip schon die antiken Griechen echauffiert haben.
Im Geisterhaus toter Avantgarden
Der Verfasser wähnt sich in einem Geisterhaus toter Avantgarden, auf nachrichtlicher Ebene sei allein schon das ewige Intendanten-Karussell furchtbar öde. Beim Berliner Theatertreffen kreise alles um immer ähnlich gelagerte Positionen, Projekte und Performer.
So manchen Unmut kann man nur zu gut nachvollziehen. Der Mann schreibt sich in einen solchen Zorn hinein, dass ihm auch die hoch gehandelte, sorgsam an den Texten arbeitende Regisseurin Andrea Breth nur mehr als einfältig arrogant gilt. Gleichzeitig preist er die Verrisse seines (heute arg vermissten) Ex-Kollegen Gerhard Stadelmaier von der FAZ, der freilich den hier leichthin abgetanen Luc Bondy und just Andrea Breth am allerhöchsten geschätzt hat.
Vorbild „Monaco Franze“
Als man sich schon bang fragt, ob Küveler irgendwann einmal halbwegs abgekühlt argumentieren wird, empfiehlt er eine distanzierte, unprätentiöse und uneitle Haltung zum Theater, wie sie einst der legendäre „Monaco Franze“ vorgemacht hat, als der in Helmut Dietls famoser Fernsehreihe die versammelten Opern-Schnösel von München düpierte.
Nun, das mag erst einmal angehen, doch wird es gewiss nicht alle Gebrechen des Theaters kurieren, von dem Küveler (immer noch) meint, es sei zu feierlich und werde oft für Träger von Zylinderhüten gemacht. Nanu? Das mag gelegentlich noch im Wiener Burgtheater der Fall (gewesen) sein, aber sonst doch wohl gar nicht mehr.
Dabei kennt Küveler doch seine brachialen Pappenheimer, jene Regisseure, die stets auf schrankenlose Selbstverwirklichung und „Skandale“ aus sind, welche sich aber längst erledigt haben.
Die Freuden der Langeweile
Er erregt sich noch königlich über Elfriede Jelineks unaufhörliches Besserwisserinnen-Theater (bis hin zu „Die Schutzbefohlenen“), das keinerlei Überraschungen mehr bereithalte, sowie über Elaborate der „Gießener Schule“ um Michael Thalheimer und René Pollesch, die auch nur noch nerve.
Aufgeregten Projekten, die nur zum Schein die Zuschauer einbezögen, in Wahrheit aber auf deren Passivität setzten, sei allemal Langeweile vorzuziehen, die wenigstens stille Kontemplation ermögliche. Also, Leute, beschwert euch bloß nicht mehr über endlos erscheinende Theaterabende, sondern sitzt eure Kultur gefälligst ab und nutzt die unverhoffte Chance zur Trance.
Damit hätten wir also schon einige, in sehr verschiedene Richtungen zielende Ablehnungen beisammen. Ja, was aber dann? Was dürfen wir hoffen? Was sollen wir ersehnen? Selbstverständlich läuft auch dieses Buch in seinem vermeintlichen Theaterhass darauf hinaus, dass es letztlich nur auf ein anderes Theater erpicht ist. Dieser Topos einer fortwährenden Hassliebe ist gleichfalls altbekannt. Doch wohin geht die Reise?
Kronzeuge Ersan Mondtag
Zum Kronzeugen bestellt Küveler den Theatermacher Ersan Mondtag, der ausgiebig als Prophet einer Art Meta-Theater – gern mit Laiendarstellern und zeichenhaften Masken – zu Wort kommt und sich dabei reichlich autoritär gebärdet. Da erklingt so manche Hohlformel (Dekonstruktion war gestern, jetzt muss wieder konstruiert werden), wobei am Horizont ein Theater aufscheinen möge, in dem wieder „alles möglich“ sein solle. Schauspielkunst herkömmlicher Prägung ist dabei übrigens überhaupt nicht gefragt, sie stört eher.
Sodann benennt Küveler drei angeblich allesamt erhellende Provokationen der neueren Theatergeschichte – ins Werk gesetzt von Hans Neuenfels (1966 in Trier, ach Gottchen!), von Rainer Werner Fassbinder („Der Müll, die Stadt und der Tod“) und vom fast nur dadurch bekannt gewordenen Schauspieler Thomas Lawinky, der den schon erwähnten Rezensenten Stadelmaier auf offener Szene verhöhnte und ihm den Notizblock entriss. Wer hätte gedacht, dass eine solche Handlungsweise noch einmal als vorbildlich durchgeht?
Bloß nicht feige sein…
Das ist also mal eine hübsche Ahnengalerie fürs kommende Theater. Küvelers Zwischenfazit lautet, Theater dürfe nicht feige sein und solle Tabus brechen. Moment mal. Hatten wir das nicht schon seit ein paar Jahrzehnten? Immer mal wieder, immer wüster und verzweifelter?
Vermeintlich rasant und doch nur halbstark geht’s in die Schlusskurven. Gepriesen werden die „Akzelerationisten“ der Bühne, die quasi gehörig aufdrehen und es den „Spaßbremsen“ im Gefolge der Frankfurter Schule mal so richtig zeigen. Wow, dann müssten die Bühnen wohl schleunigst tiefergelegt werden. Angewidert von den gängigen Moden, wendet sich Küveler nunmehr dem nächsten Hype zu.
Die Heilsbringer kommen
Der gute alte Textzerbröseler Frank Castorf darf dabei gleichfalls Pate stehen, außerdem vor allem Leute wie der Norweger Vegard Vinge und Ina Müller, die an Castorfs Volksbühne derart hirnmarternd, radikal und monströs zugange sind, dass es selbst dem von Chaos gestählten Chef manchmal zu viel wird.
Die Zumutung ist dabei offenbar zentrales Programm. Hört sich nicht so an, als könnte dies dem deutschen Stadttheater aufhelfen. Im Gegenteil: Endlose Proben, oft ohne bühnenreifes Resultat, sind dort nicht so gern gesehen. Derlei Kleinigkeiten erwähnt Küveler in seinem Buch kaum, er beschwört nur raunend die Namen der Heilsbringer Vinge oder Antú Romero Nunes, ohne die Verheißungen zu konkretisieren. Und ums gewöhnliche Stadttheater ist es Küveler wohl gar nicht zu tun.
Natürlich gibt es, zumal in der Hauptstadt, eine eventgeile Theater-Schickeria, die auch Hervorbringungen à la Vinge noch kritiklos goutiert. Mal abgesehen von diversen Fäkal-Aktionen, ließen Vinge und Müller einst vor Publikum ungerührt bis 5000 zählen und haben damit laut Küveler (produktive?) Wut erzeugt. Die Zukunft des Theaters käme somit aus der Weißglut, womit Theaterhass endlich, endlich sinnerfüllt wäre. Ja, Donnerschlag und Sakrament…!
Jan Küveler: „Theater hassen. Eine dramatische Beziehung“. Tropen Verlag (Klett-Cotta). 160 Seiten. 12 €.


