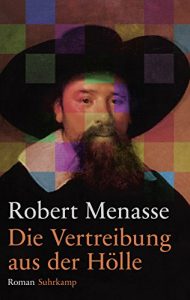Robert Menasse hat vor knapp 20 Jahren anlässlich des Erscheinens seines Romans „Die Vertreibung aus der Hölle“ einen Satz gesagt, dessen bittere Wahrheit auch angesichts der Corona-Pandemie zutreffend bleibt: „Im Buch geht es aber nicht vor allem um die Abgründe, sondern eher darum, wie unernst wir uns verhalten, wenn wir in die Abgründe schauen.“
Ein Satz, den Menasse damals jedoch nicht auf den Umgang des Menschen mit Natur oder Naturgeschichte münzte, sondern auf menschliche Geschichte – und ihn also so fortsetzte: Es gehe auch darum, wie „wir mit Geschichte umgehen, wie wir sie missbrauchen, was wir vorgeben aus ihr gelernt zu haben, was wir uns weigern aus ihr zu lernen, wie wir sie oft hilflos nachspielen.“
Unheils-Geschichte mit Lichtblicken
Die neuerliche Lektüre des – paradox gesagt – Menasse’schen historischen Gegenwartsromans bestätigt den damaligen Leseeindruck. Menasses Erzählen, sein literarisches Vexierspiel erschreckt, rührt an, lehrt und unterhält immer noch. Schmerzhaft reich ist der Roman an Unheils-Geschichten und Fakten, reich an Figuren, Menschen und Unmenschen, komplex und voller doppelter, dreifacher Böden.
Menasse erzählt da einmal die Geschichte um den Jungen Manoel Dias Soeira. Manoel ist Sohn zwangsgetaufter Neuchristen, sog. Marranen, die Anfang des 17. Jahrhunderts im Königreich Portugal und inmitten der Inquisition ihr heimliches Judentum praktizieren, verfolgt, gefoltert werden und nach Amsterdam flüchten müssen, wo Manoel als Samuel Manasseh zum angesehenen Rabbi und sogar zum Lehrer Baruch de Spinozas wird.
Was ist bloß aus uns geworden? Wer waren die, die unsere Lehrer waren?
Und dann gibt es die Handlung um den in der Gegenwart lebenden Historiker Viktor Abravanel, der ein Klassentreffen 25 Jahre nach der Matura platzen lässt, weil er NSDAP-Mitgliedsnummern der ehemaligen Lehrer verliest und sich danach im Gespräch mit einer einstigen Angebeteten vergeblich seiner eigenen Kindheit und Jugend zu vergewissern sucht. Viktor ist Kind von Nazi-Opfern und auf dem Weg zu einem Vortrag in Amsterdam, der den Titel tragen soll: „Wer war Spinozas Lehrer?“ – die Verbindungen zwischen Manoel und Viktor werden hier das erste Mal angedeutet. Und wie Viktor wird uns auch Manoel zunächst über eine von ihm begangene Provokation, einen Tabubruch vorgestellt, dessen Folgen er nicht mehr unter Kontrolle hat.
Der Roman beginnt mit einer grotesken Szene, einem Trauerzug mordlustiger Bürger und der Inquisition im Städtchen Vila dos Começos, inszenierter Marsch eines antisemitischen Mobs, der eine zuvor vom achtjährigen Manoel gekreuzigte Katze zu Grabe trägt. Mit der symbolisch-antichristlichen wie boshaften Kreuzigung hatte sich Manoel zuvor für die Verhaftung des Vaters durchs Heilige Offizium rächen wollen.
Zersplittertes Leben
Robert Menasse komponiert die zum Roman geschnürten Bündel Lebenssplitter der beiden Antihelden Manoel und Viktor ebenso kunstvoll wie die Brüche in ihren Biografien, wie die Opfer-, Mitläufer- oder Tätermomente in ihrer beider Romanleben. Stimmungen, Figuren und Motive gehen ineinander über, ganze Sätze tauchen in beiden Handlungssträngen auf. Seite für Seite wird deutlicher, wie gekonnt Robert Menasse zwei Erzählebenen zu einem eigenwilligen durchgehenden Text über zwei Leben und Zeiten verknüpft.
Die drei Erzählperspektiven eines wissenden Erzählers, des Viktor Abravanel und Samuel Manasseh erlauben dem Autor dabei, ein Spiel mit Tragik und Frechheit, Komik und Formen des Wahns, mit Angst & Ängstlichkeit, Doppelleben und Identitätsverlust. Oft beiläufig, aber nie nebenbei wird das Ungeheuerliche erzählt, kleine und große Katastrophen ebenso wie das Scheitern im Alltag.
Der gemachte Jude
Mit den Figuren der Familien Soeira/Manasseh und Abravanel thematisiert Robert Menasse traumatische Verfolgungs- und Überlebensgeschichten. Immer wieder spürt er den pathologischen Beziehungsstrukturen von Juden und Andersgläubigen nach. Dabei wird eins zunehmend deutlicher: Es ist die Wahrnehmung der jeweils anderen, die einen erst – mehr als man es sich selbst wünschen kann und will – zum Juden macht. Um die bohrenden Blicke der anderen etwas weniger schmerzhaft zu erleben, tut man ihnen den Gefallen und verbiegt sich, versteckt sich, verleugnet sich, ohne dadurch dem Hass, auch dem auf andere und sich selbst entgehen zu können.
In Kürzestgeschichten und Personenportraits schreibt der Autor so vom trostlos-tragischen Leben zweier jüngerer Verlorener, die keine Verlierer sein wollen. Er zeigt uns aber auch die Innenansichten der älter gewordenen Außenseiter, die sich hinter Zynismus oder in ihrer Verzweiflung verstecken, weil sie ihre Einsamkeit kaum auszuhalten vermögen.
Kein Judentum, nur Judentümer
Wie ist und war es, als Mensch jüdischer Herkunft oder Glaubens inmitten oder ‚unter’ der Mehrheit zu leben? Der Text handelt von Fremdenfeindlichkeit, von offener und öffentlicher Brutalität und Fanatismus, aber eben auch von der utopischen Möglichkeit der Selbstbehauptung, des kritischen Denkens, den Versuchen zivilen Ungehorsams, die oft genug nur noch lächerlich scheinen und kläglich enden.
Der Rabbiner Leo Baeck hat einmal gesagt, es gebe kein Judentum, nur Judentümer. Und so viele Judentümer es gibt, so viele Abgrenzungen davon und Auseinandersetzungen damit gibt es auch, so viel Pluralität jüdischen Lebens so viele Möglichkeiten, ein subjektives Verhältnis zum Judentum zu leben.
Es ist Teil des literarischen Projektes zeitgenössischer mit dem Judentum verbundener Schriftstellerinnen und Schriftsteller, jüdische Identität immer neu zu reflektieren, zu entdecken oder zu entwerfen. In Robert Menasses Roman als subversiver Rekonstruktion oder Rückprojektion dessen, was vielleicht gewesen sein könnte, scheinen seine Recherchen und Fantasien zu Juden in Portugal, Amsterdam und Österreich, zu Manasseh und Abravanel vor allem zu sagen, dass überhaupt nicht sicher ist, wie man sich das vorstellen muss: Geschichte, Heimat, Fremde, Identität und Ich, Liebe oder Hass.
Hölle und Paradies – zwei Seiten derselben falschen Münze?
2001 bei einem Leseabend im Jüdischen Museum in Dorsten hat die damalige Leiterin, die Ursulinen-Schwester Johanna, als Moderatorin die Frage gestellt, wohin man denn eigentlich gelange, wenn man aus der Hölle vertrieben werde? Gute Frage. Und: Nein, Robert Menasses Antwort darauf werde ich nicht verraten. Sein Roman „Die Vertreibung aus der Hölle“ selbst dürfte sowieso die beste (weil komplexe) Antwort darauf sein.
Auf dem Rückseitencover meines Roman-Exemplars findet sich in zwei sarkastischen Sätzen immerhin eine Spur: „Die Hölle erkennen wir immer erst rückblickend. Nach der Vertreibung. Solange wir in ihr schmoren, reden wir von Heimat.“ Nach der Vertreibung aus der Hölle all dessen, was wir Heimat nennen, kämen also erst einmal das Elend und Glück der Erkenntnis? Das Paradies – so viel weiß ich aus eigener Erfahrung – wäre das jedoch ganz und gar nicht, auch wenn gelegentlich beim Nachdenken der Himmel aufreißt.
Robert Menasse: „Die Vertreibung aus der Hölle“. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 2001. 493 Seiten, Hardcover.