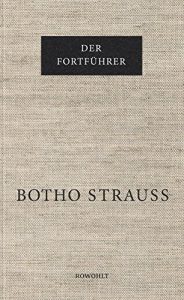Eigentlich nichts Ungewöhnliches: Ein Mann wird älter und denkt vermehrt ans Vergangene. Früher war nicht alles besser, es kam einem aber vertrauter und vielleicht weniger verfälscht vor. Botho Strauß (erscheint jetzt bei Rowohlt und nicht mehr bei Hanser) empfindet sich wohl seit jeher als ein „Fortführer“, dem Althergebrachten verpflichtet, daran anknüpfend. Und als jemand, der sich und womöglich auch uns fort, also hinweg führt von arg begrenzter Tagvernunft.
In seinem Buch „Der Fortführer“ ist derlei Überlieferungs-Bewusstsein die treibende, besser: die entschieden beharrende Kraft. In vierzehn schmucklos durchnummerierten Kapiteln („Eins“, „Zwei“…) dieses nahezu nachkriegshaft karg gestalteten – man muss es wohl so nennen – Alterswerks gibt sich Botho Strauß abermals vielfach als Künder und Seher, jedoch nicht als Allwissender, sondern als Suchender und Empfangender. Immer wieder hebt er kostbare alte Worte und Wendungen ans Licht; ganz so, als wolle er nur ungern „verstanden“ werden. Es entstehen dabei zahllose sperrige Sätze: „Abgrund, Numen und Werg, das in Gestalt eines Wühlers durch unsere Sprache buckelt und findet den Ausgang nicht mehr?“
Gegen die „blöde Gescheitheit“
Zuwider wie nur eh und je sind Strauß das haltlose Geschwätz des Tages, die allfällige „Kommunikation“ (bei ihm geradezu ein Schimpfwort), die Zumutungen der „blöden Gescheitheit“ und der oberfächlichen Verständigung. Wie zur Abschottung von der hohlen Gegenwart sucht er – in ausgefeiltester Sprache – vorsprachliche Gefilde auf, so etwa die Traumwelt, wie schon so viele Künstler vor ihm. Er preist „Das nicht mehr vorsagende, den Klippschüler der Tagvernunft nicht spicken lassende Träumen.“ Ein Bild, das sich aus frühen Schülertagen speist.
Alles Gewesene hinterlässt einen unstillbaren Schmerz, so dass nach Strauß‘ Ansicht niemand ganz und gar im Jetzt lebt, selbst all die vielen „Gegenwartsnarren“ nicht. Doch dieser Autor richtet seinen Sinn nicht allein aufs Unvordenkliche, er begibt sich wieder und wieder auch auf Fährtensuche im Neuesten und Gängigen, in den digitalen Netzen, in den Clouds und im allfälligen, blicklosen Starren auf Smartphones, das so gar kein Schauen mehr ist.
Das Mädchen mit dem iPhone als Bellini-Madonna
An einer Stelle gemahnt jedoch ein Mädchen, „das mit gesenktem Kopf auf sein iPhone sieht“ an ein „Antlitz, das so edel und leer ist wie das gewisser Bellini-Madonnen“. Tut sich hinter all dem digitalen Wirrwarr womöglich ein neuer Mythenquell auf – oder rauscht die ganze Chose nur dem Nichts entgegen? Herrscht lediglich Schwund? Sollen wir denn vollends kapitulieren und, wie Strauß es formuliert, „Mit den Händen eine Kelle formen, unseren Hirnglibber ausheben und in die digitale Schale betten“?
Es dürfte schwerfallen, einen rundum passenden Gattungsbegriff für dieses Buch zu finden. Man mag von Notaten, Aphorismen, Maximen und Reflexionen sprechen. In anderen Passagen wird die Grenze zur lyrischen Ausdrucksform gestreift. Skizzenhaft werden auch Szenarien für imaginäre Bühnen entworfen. Durchweg gilt: Die kurzen, eigentlich recht lesefreundlich gesetzten Abschnitte täuschen Bekömmlichkeit nur vor. Hieran muss man sich abarbeiten und hoffen, dass sich die eine oder andere Ratlosigkeit als produktiv erweisen möge. Wohlfeile Verständigungsliteratur führt einen ja auch wirklich nicht weiter und führt einen nicht fort.
Bekenntnis zum elitären Dasein
An ein solches Buch sollte man auch nicht platterdings die Frage richten, ob es reaktionär und „rechtslastig“ sei. Man könnte Strauß aus bestimmten Perspektiven als erzkonservativ schelten, doch weiter reichende Zuschreibungen gehen gründlich fehl. Hier geht es denn doch um weitaus mehr, wenn nicht ums Ganze. Etwa um die Conditio humana jedes Kindes, das zürnt: „Die Welt ist fertig, der Menschen Zeug ist komplett, und nur ich rackere mich ab mit dem elenden Werden!“ Und was ist mit den Älteren? „Zeitlebens welch Mangel an Existenz! Viel herumgestanden, mehr erwartet.“ Wie überaus klar Botho Strauß schreiben kann. Leuchtend klar. Erschütternd klar.
Deutlich bekennt er sich freilich zum herausgehobenen, elitären Dasein. Übers Werk eines ernsthaft Denkenden und Schreibenden: „Er leistet bestimmt mehr Verwertungsarbeit als jeder Werktätige an der Fertigungsstraße. Passivität ist dafür unabdingbar, ist Voraussetzung für die Höchstleistung eines Ichs, das sich seiner Sonderstellung (…) versichern muss.“ Nur so könne der „Erdkrüppel Mensch“ Signale „aus der Senkrechten“ empfangen. Selbst bloße Passivität ist letztlich nicht genug: „Man muß auf das Wunder der Erschöpfung vertrauen.“
Wenn die Welt zur Ruhe kommt
Die erdrückende Mehrheit der Alltagsmenschen sei hingegen hiermit befasst: „…nur hamstern, sparen, raffen, heimsen, zählen“. Wer wollte da grundsätzlich widersprechen?Doch wie verwundert ist der Berichtende, wenn er einmal „Unter Menschen!“ geht und beim Schulfest seines Patenkinds mit dem Schöpflöffel Erbsensuppe ausschenkt. Gewiss, es ging heiter zu. Und er ist mit vielen ins Gespräch gekommen. Doch, ach, „die Redewendungen des Austauschs wiederholten sich viel zu oft.“ Gar viel verlangt. Wäre denn eine Welt möglich und wünschenswert, in der alle Geschöpfe immer Ungeahntes und Wesentliches von sich geben? Stets nur Schöpfung statt Schöpflöffel?
Das letzte, längere Kapitel ist nicht mehr nummeriert, es heißt wie das ganze Buch: „Der Fortführer“. Hier nun scheint sich manches zu lichten, was vordem kryptisch geklungen hat. Hier nun werden unzeitgemäße Künstler wie beispielsweise Keyserling, Elgar, Pfitzner und Sibelius gepriesen. Im Musikalischen, so scheint es, kündigen sich die Chiffren des Eigentlichen besonders nachdrücklich an.
Und was steht am Ende, worauf läuft es hinaus? Auf den endlich angehaltenen Fortschritt, auf die „glücklichste Vision“ einer „zur Ruhe gekommenen Welt“, allen Aufregungen enthoben. Eine Anschauung, die weit über modische „Entschleunigungs“-Sehnsüchte hinaus reicht!
Botho Strauß: „Der Fortführer“. Rowohlt Verlag, 203 Seiten. 20 Euro.